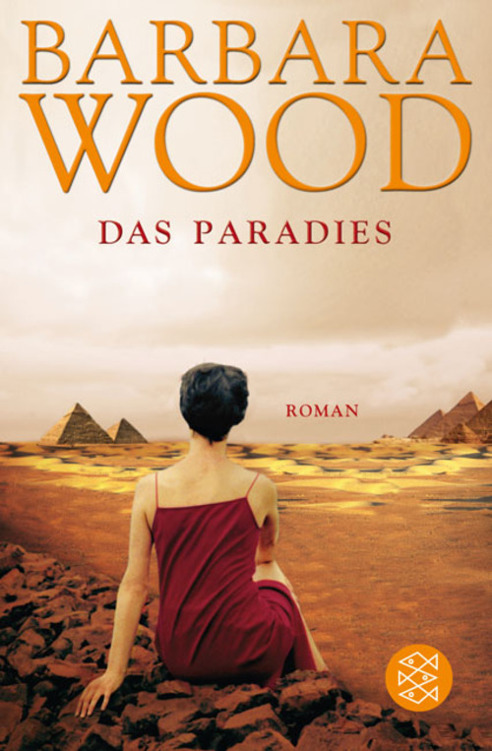![Das Paradies]()
Das Paradies
vielleicht recht. Sie soll an dieser Stelle«, sie deutete auf den eigenen Unterleib, »unter ihr Kleid zwei schwarze Federn legen. Sie muß die Federn sieben Tage lang tragen und jeden Tag siebenmal die erste Sure des Koran sprechen. Dann muß sie die Federn sieben Tage beiseite legen und sie danach wieder tragen. Wenn sie das mehrere Wochen lang tut, wird es den Dschinn austreiben.«
Es war nicht das erste Mal, daß Amira Magie als Heilmittel verordnete. Denn vor ihrer wissenschaftlichen Ausbildung war sie lange Jahre von Umma Khadija in das geheime Wissen einer Heilerin eingeweiht worden. Sie spürte, wie Ägypten mit jedem goldenen Sonnenaufgang und jedem scharlachroten Sonnenuntergang mehr Besitz von ihr ergriff – das alte mystische Ägypten, die Urkräfte seiner Kultur. Sie war dankbar, daß sie jetzt den Frauen in den Dörfern mit diesem alten Erbe helfen durfte.
Amira hörte in den sternenklaren Nächten das Heulen von Dschinns, wenn sie dem Wind lauschte, und bei jeder Entbindung sprach sie Zaubersprüche, um den bösen Blick abzuwenden. Amira verstand die Macht der jahrhundertealten Geheimnisse. Sie hatte erlebt, wie Magie Krankheiten heilte, die Antibiotika nicht heilen konnten, sie hatte gesehen, wie die Macht des Aberglaubens siegte, wo die Medizin versagte.
»Sehen Sie nur, wie der Sajjid Sie beobachtet, Doktorin«, sagte Um Jamal, und die Frauen warfen schnelle scheue Blicke über den Platz auf Declan. »Mein Mann soll sich von mir trennen, wenn der Doktor Sie nicht liebt!«
Das Lachen der Frauen drang über den Platz wie das Schlagen von Vogelschwingen. Die jungen Frauen genossen die seltene Möglichkeit, sich zu treffen und sich zu unterhalten. Meist mußten sie in der strengen Abgeschlossenheit ihrer Lehmhäuser bleiben und arbeiten.
»Heute abend, beim Fest des Propheten, werde ich für Sie einen Liebeszauber über den Sajjid werfen, Doktorin.«
»Das wird nichts nützen«, erwiderte Amira. »Dr. Connor wird bald weggehen.«
»Dann müssen Sie ihn dazu bringen, daß er bleibt, Sajjida. Es ist Ihre Pflicht. Die Männer glauben, sie können kommen und gehen, wie es ihnen gefällt. Wir Frauen sehen jedoch, was richtig und was falsch ist. Wir müssen sie lenken, auch wenn ihnen das nicht bewußt ist, denn sonst entsteht aus ihrer Unwissenheit großes Unheil.«
Die jungen Ehefrauen lernten erst die Macht kennen, die sie über die Männer hatten. In der Dorfgemeinschaft standen ihnen die alten Frauen mit Rat und Tat zur Seite. Sie nickten verständnisvoll und begannen mit einem Blick auf Connor zu kichern.
»Die Sajjida soll den Doktor heiraten und Kinder bekommen«, erklärte Um Tewfik. Die älteren Frauen stimmten ihr zu. »Wir werden auf unsere Weise dafür sorgen, daß Sie bei uns glücklich sind«, versprach die alte Frau.
»Ich bin zu alt, um Kinder zu bekommen, Umma«, sagte Amira, während sie das Stethoskop abnahm und in die Arzttasche legte. »Ich werde bald zweiundvierzig.«
Aber Um Jamal, die beneidenswerterweise zweiundzwanzig Enkelkinder hatte, warf Amira einen verschmitzten Blick zu und sagte: »Sie können immer noch Kinder bekommen, Sajjida. Ich war bei meinem letzten beinahe fünfzig. Mein Mann soll sich von mir trennen«, fügte sie mit einem zufriedenen Seufzer hinzu, »wenn ich ihm nicht neunzehn Kinder geboren habe, die alle am Leben sind! Er hat niemals eine andere Frau angesehen!«
Amira lachte. Aber sie dachte daran, daß sie manchmal den Schmerz um den Verlust ihrer zwei Kinder empfand, wenn man ihr ein Baby auf den Arm legte oder wenn sie Mütter und Töchter zusammen sah. Sie fand sich zwar mit dem Verlust ab, aber manchmal fragte sie sich trotzdem, wie es wäre, selbst eine kleine Tochter zu haben. Sie dachte an das arme kleine Engelchen, das am Vorabend des Sechs-Tage-Kriegs zur Welt gekommen war. Wenn das Kind überlebt hätte, wäre es inzwischen einundzwanzig Jahre alt gewesen. Es hätte Amira nicht gestört, daß sein Vater Hassan al-Sabir hieß; sie hätte das Kind mit der gleichen Hingabe geliebt wie diese Fellachenmütter ihre Töchter. Und sie dachte jeden Tag an ihren Sohn: Erinnert sich Mohammed noch an mich? Sprach er jemals von ihr? Stellte er Fragen? Glaubte er, sie sei noch am Leben, oder war sie für ihn jemand, dessen Photos aus dem Familienalbum entfernt worden waren, eine Frau, die so gut wie tot war, so wie Tante Fatima? Was hätte Amira nicht darum gegeben, Mohammed ein einziges Mal wenigstens von weitem zu sehen. Sie wollte keinen Kontakt
Weitere Kostenlose Bücher