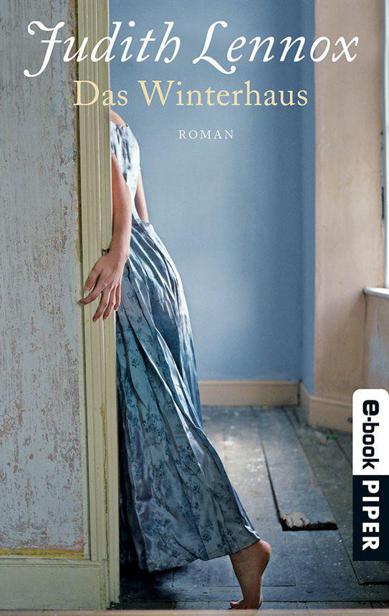![Das Winterhaus]()
Das Winterhaus
Hugh, damals, vor vielen Jahren. Die Telegramme hatten den ganzen Tag im Vestibül auf dem Tisch gelegen …
»Ich kann nicht«, sagte sie leise zu Joe. »Bitte. Könntest du …?«
Als er das Telegramm aufriß und entfaltete, sagte sie: »Hugh?« Er sah auf und schüttelte sofort den Kopf.
»Nein. Aber es ist von deiner Mutter. Es geht um jemanden namens Merchant.«
Robin nahm Joe das Telegramm aus der Hand und las es selbst. »Vernon Merchant tot stopp Amtliche Untersuchung fünfter Januar stopp Mutter stopp«
Sie mußte es mehrmals lesen, ehe ihr der Sinn der zusammenhanglosen Worte klar wurde. Ihre erste Angst um Hugh wurde beinahe sofort von einer gänzlich anderen Art der Furcht verdrängt. Sie hörte Maias Stimme. Ich mag ihn vielleicht nicht; aber ich mag sein Geld …
Sie nahm wahr, daß Joe mit ihr sprach. Sie sagte: »Maia Merchant ist eine alte Freundin von mir. Sie und Vernon haben erst letztes Jahr geheiratet.«
Miss Turner schnalzte aufgeregt, Joe sagte: »Das tut mir leid, Robin. Hattest du ihn gern?«
Sie sah ihn überrascht an und erwiderte: »Nein. Er war abscheulich.« Erst da fiel ihr ein, was Maia noch zu ihr gesagt hatte.
Du wirst keinem Menschen etwas über mich und Vernon sagen, Robin. Schwörst du es mir?
Und sie hatte es geschworen. Sie hatte der verletzten, gebrochenen Maia versprochen, daß sie das Geheimnis ihrer katastrophalen Ehe für sich behalten würde. Hastig sagte sie: »Ich meine – die Ehe und das alles. Du weißt, daß ich davon nichts halte, Joe.«
»Kurz vor Weihnachten war eine Mrs. Merchant hier und wollte Sie besuchen, Miss Summerhayes«, berichtete Miss Turner zaghaft. »Ich habe ihr gesagt, Sie seien im Ausland.«
Sie fühlte sich matt. Sie wollte allein sein, brauchte Zeit, um nachzudenken. Nachdem sie sich von Joe verabschiedet hatte, lief sie aus dem Haus zum Postamt. Sie schickte ihrer Mutter ein Telegramm, um ihr mitzuteilen, daß sie am folgenden Tag nach Hause kommen würde, dann kehrte sie langsam, tief in Gedanken, zur Pension zurück. Die Folgerungen, zu denen ihr Nachdenken sie führte, waren düster und beunruhigend.
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, daß es beinahe fünf war, und ihr fiel ein, daß Donnerstag war, der Tag, an dem sie immer in der Klinik arbeitete.
Die Schlangen schniefender Kinder und müde aussehender Frauen schienen länger zu sein als sonst. Die letzte Patientin ging erst nach neun Uhr. Dr. Mackenzie schrie Robin an, sie habe seinen Rezeptblock verlegt; doch Robin schrie nicht zurück, wie sie das sonst tat, sondern setzte den Kessel auf und machte eine große Kanne Tee. Sie stellte sie zusammen mit Geschirr, Zucker und Milch auf ein Tablett, das sie zu ihm hineintrug.
Er saß an seinem Schreibtisch hinter Bergen von Akten, ein kräftiger, gutmütiger Mann Mitte Vierzig mit einer Neigung, schnell loszupoltern. Er sah auf, als Robin hereinkam.
»Ich hab ihn wieder.« Er schwenkte den Rezeptblock. »Er war unter dem Telefonbuch.«
Sie lachte und schenkte den Tee ein.
»Sie haben den ganzen Abend kaum ein Wort gesagt, Robin. Sonst reden Sie doch wie ein Buch. Was ist denn los?«
»Ach, nichts weiter. Nur zwei Kleinigkeiten, die mir im Kopf herumgehen.«
»Heraus damit. Ich kann nicht zulassen, daß Sie mir hier schlappmachen. Sie sind seit Jahren meine beste Assistentin.«
Das seltene Kompliment tat ihr gut. »Na ja – ich hab meine Stelle verloren.«
»Ach. Das ist wirklich Pech. Noch eine Arbeitslose mehr, hm?«
Sie nickte. »Wenn ich nichts anderes finde, werde ich wohl wieder nach Hause gehen müssen.« Eine schreckliche Aussicht.
Er sah sie scharf an. »Und das wollen Sie nicht?«
Sie schüttelte mit Nachdruck den Kopf.
»Könnten Sie es aushalten, mit mir zusammenzuarbeiten?«
Robin starrte ihn an. »Was – ganztägig, meinen Sie?«
Mindestens – ich könnte Ihnen allerdings nur einen Hungerlohn zahlen.«
Beide Hände um ihre Teetasse gelegt, sagte sie leise: »Sagen Sie mir mehr.«
»Sie wissen, daß mein Interesse den Armutskrankheiten in dieser Gegend gilt – Tuberkulose, Rachitis, Diphtherie und so weiter. Ich versuche einen Aufsatz für eine der medizinischen Fachzeitschriften zu schreiben, aber ich bin dabei auf ein Problem gestoßen. Ich kann ohne Schwierigkeiten Material über die Krankheiten zusammenbringen – ich sehe sie ja jeden Tag. Aber es gibt eine Menge Dinge, die ich nicht weiß – ich weiß zum Beispiel nichts über die Ernährung meiner Patienten, und ich weiß nicht genug
Weitere Kostenlose Bücher