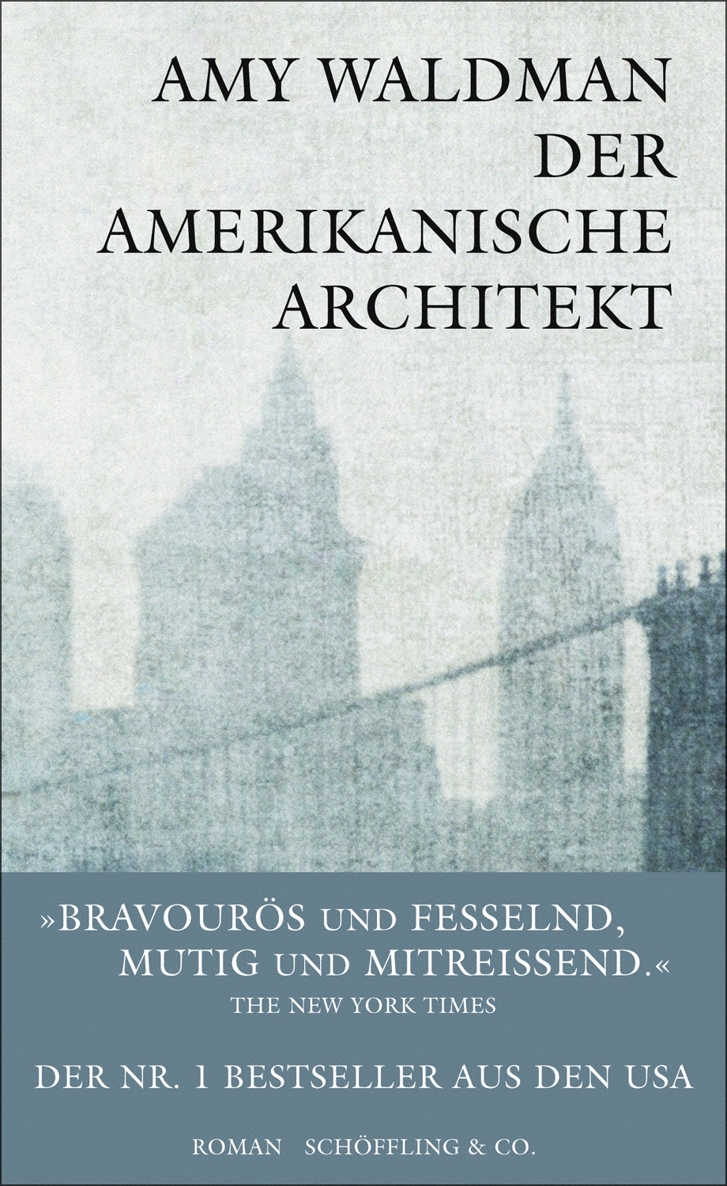![Der amerikanische Architekt]()
Der amerikanische Architekt
allem war er voller Trauer. Nach dem Streit mit Laila hatte er seine Koffer gepackt, ihre Schlüssel auf den Tisch gelegt und war in ein Hotel gegangen. Kurz darauf bot ihm eine Kollegin ihre leere Wohnung in Chelsea an, aus der sie gerade ausgezogen war. Es war die minimalistischste Zuflucht überhaupt. Mos Leben war auf einen Koffer, den Laptop und eine Luftmatratze zusammengeschrumpft, die karge Habe eines Mannes, der nicht so sehr gejagt, als vielmehr langsam ausradiert wurde.
Auf der Arbeit schienen alle um ihn herum nicht etwa über Gebäude zu reden, sondern über Essen: was es zum Dinner gegeben hatte (»Hast du schon mal rohe Jakobsmuscheln probiert? Die kleinen? Ein Gedicht!«), wo sie zum Mittagessen hin wollten. Es war wie damals, als er als Jugendlicher den Sex entdeckte und sein aufgegeiltes Hirn ihn in jedem Geruch, jedem Hüftschwung, jeder Unterhaltung fand. Ihm war nicht klar gewesen, in welchem Ausmaß Essen – die Planung, die Beschaffung, die Vorbereitung, der Verzehr, das Reden darüber, seine Vergeudung, seine Fetischisierung, seine Erzeugung, sein Verkauf – das Amerika des 21. Jahrhunderts prägte. Ehe er mit Fasten anfing, war es ihm magisch vorgekommen, sogar edel, freiwillig auf das alles zu verzichten. Sein Rhythmus war immer kontrapunktisch gewesen, und er wusste, dass ihm das Fasten in einem muslimischen Land weit weniger liegen würde, da es dort Konformität bedeutete, anstatt ein Verhalten gegen die Norm. Aber es war schwerer, als er gedacht hatte, unter Menschen zu sein, die sein Opfer nicht nur nicht teilten, sondern auch keine Rücksicht darauf nahmen.
Den ganzen Vormittag hindurch quengelte sein Körper. Seine Gereiztheit wuchs, je mehr sein Blutzuckerspiegel absank. Sein Urin sah so chemisch gelb aus wie das Gelb einer Verkehrsampel und war so konzentriert, dass er fast solide wirkte. Aus Angst vor Mundgeruch wölbte er ständig die Hand vor die Lippen, um seinen Atem zu kontrollieren, und vermied es, anderen zu nahe zu kommen. Er konnte sich zwar die Zähne putzen, solange er dabei kein Wasser schluckte, aber durch das Fasten stieg ein unangenehmer Geruch aus seinem Magen auf, weil die Säuren nichts hatten, womit sie arbeiten konnten. Im Mund hatte er einen Geschmack wie von einem toten Tier, das irgendwo unter dem Haus verweste.
Thomas blieb an seinem Schreibtisch stehen. Mehrere Kollgen wollten Sushi essen gehen. Hatte Mo Lust mitzukommen?
»Nein, ich bin schon verabredet«, sagte er und sah das Flackern des Zweifels in Thomas’ Augen: Hatte Mo etwa schon wieder Geheimnisse? »Mit Laila«, fügte er hinzu, eine Lüge, um das Misstrauen zu entschärfen. Ihren Namen laut auszusprechen war, als füge er sich selbst einen Messerschnitt zu, aber er tat es noch einmal. »Mit Laila.« Der Schmerz war mit Freude durchmischt. Sein »Assistent« hörte zu, als traue er Mo genauso wenig wie Thomas.
Die täglichen Kopfschmerzen fingen kurz danach an, setzten sich so brutal fest, wie Mos Zunge an seinem ausgedörrten Gaumen klebte. Er machte einen Spaziergang. Studenten legten trotz Ramadam ihre Examen ab, Soldaten kämpften in Kriegen, Präsidenten regierten Länder, da würde er doch wohl einen kleinen Spaziergang schaffen. Sehnsüchtig beäugte er jeden Lebensmittelstand, am meisten die, die ihre Produkte als »halal« proklamierten. Es war schier unglaublich, sich vorzustellen, dass ihre Besitzer auch fasteten. Der Geruch von gegrilltem Fleisch, von Gewürzen, der appetitliche Rauch, stieg ihm in die Nase, als wolle er sich dafür rächen, dass sein Mund verschlossen war. Mehr noch als nach Nahrung lechzte er nach etwas zu trinken – nach Wasser, nach zuckriger Orangenlimonade, nach egal was, Hauptsache, es befeuchtete seinen papiertrockenen Mund, der sich anfühlte, als sei er beim Zahnarzt leergesaugt worden. Mehr noch als nach Wasser gierte er nach einem Kaffee, um seinen Kopf von der Zwinge der Kopfschmerzen zu befreien. Er führte Selbstgespräche: Er war schwach. Nein, war er nicht. Dass er sich schwach fühlte bedeutete, dass er stark war, bedeutete, dass er durchhielt.
Am späten Nachmittag nahm er sich ein Taxi zu den Studios von WARU , wo ein junger Mann mit gelblicher Haut ihn in ein Vorzimmer führte und fragte, ob er Tee, Kaffee oder sonst etwas haben wolle.
»Nichts, danke«, sagte er.
»Vielleicht ein Glas Wasser? Es hilft, wenn man nervös ist.«
»Wieso sollte ich nervös –«, fing Mo an zu protestieren, aber das Rasseln seiner Stimme, wie belegt
Weitere Kostenlose Bücher