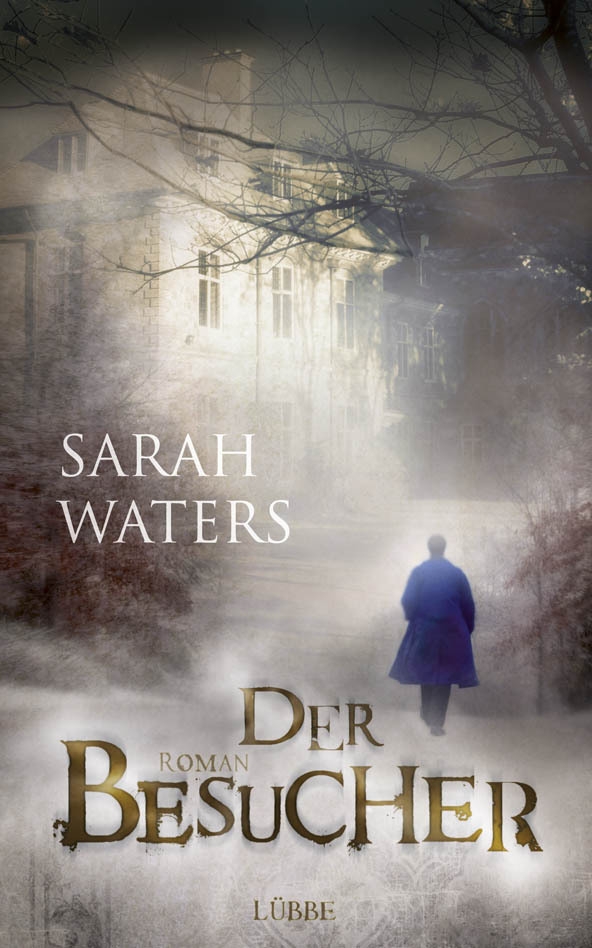![Der Besucher - Roman]()
Der Besucher - Roman
Augenblick nicht an, und es war mir unangenehm, ihr diese Frage zu stellen. Doch sie schüttelte den Kopf, ohne peinlich berührt zu sein.
»Nein, das hat er nicht. Da bin ich mir sicher. Ich weiß beim besten Willen nicht, was es war. Zuerst bat er mich, bei ihm zu bleiben. Er hielt sich an meiner Hand fest wie ein Schuljunge. Dann auf einmal besann er sich plötzlich anders und forderte mich auf, ihn in Ruhe zu lassen. Er hätte mich beinahe aus dem Zimmer geschoben. Ich schickte Betty mit Aspirin zu ihm. In diesem Zustand konnte er keinesfalls an der Gesellschaft teilnehmen. Ich musste mir eine Entschuldigung einfallen lassen. Was hätte ich denn sonst tun sollen?«
»Sie hätten es mir erzählen können.«
»Das wollte ich auch! Doch er wollte nichts davon hören. Und natürlich habe ich mir auch Sorgen gemacht, welchen Eindruck er bei den Besuchern hinterlassen würde. Ich hatte Angst, dass er auftauchen und eine Szene machen könnte. Inzwischen wünschte ich mir fast, er wäre gekommen. Denn dann wäre das arme kleine Mädchen …«
Ihre Stimme klang gepresst, bis sie schließlich ganz erstarb. Wir saßen in unglücklichem Schweigen da, und wieder gingen meine Gedanken zum Vorabend zurück, zu dem schnappenden Geräusch von Gyps Maul, dem Kreischen und dem langgezogenen Wimmern, das darauf folgte. In ebenjenem Moment hatte Rod in gestörter nervlicher Verfassung in seinem Zimmer gesessen; während ich Gillian ins Untergeschoss trug und während ich ihre Wange nähte, war er dort sitzen geblieben. Obwohl er den Lärm vor seiner Tür vermutlich gehört hatte, war er unfähig gewesen, sich zu rühren und nachzuschauen, was los war. Eine schreckliche Vorstellung.
Ich griff nach der Armlehne des Sessels: »Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden.«
Doch Mrs. Ayres machte eine abwehrende Geste. »Nein, besser nicht. Ich glaube nicht, dass er das möchte.«
»Was könnte es denn schaden?«
»Sie haben doch gesehen, wie er heute Abend war, ganz anders als sonst, so unstet und niedergedrückt. So war er schon den ganzen Tag. Ich musste ihn praktisch anflehen, dass er sich überhaupt zu uns setzte. Seine Schwester weiß nicht, in welchem Zustand ich ihn gestern Abend vorgefunden habe; sie glaubt, er hätte bloß starke Kopfschmerzen gehabt und sich hingelegt. Ich glaube, er schämt sich. Ich denke … Ach, Dr. Faraday, ich muss immer daran denken, wie er war, als er aus dem Krankenhaus nach Hause kam!«
Sie blickte zu Boden und begann wieder, an ihren Ringen zu drehen. »Ich habe bisher nicht mit Ihnen darüber gesprochen«, sagte sie, ohne meinem Blick zu begegnen. »Sein Arzt hat es damals als Depression bezeichnet. Aber ich hatte den Eindruck, es war mehr als das. Er schien niemals zu schlafen. Er hatte plötzliche Wutanfälle oder schmollte stundenlang vor sich hin. Er gebrauchte schreckliche Schimpfwörter. Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Meinen eigenen Sohn! Monatelang war er so. Ich konnte niemanden mehr hierher einladen, so sehr habe ich mich für ihn geschämt!«
Ihre Worte kamen nicht völlig überraschend für mich, schließlich hatte David Graham mir gegenüber im Sommer bereits Rods »nervliches Problem« erwähnt, und nach allem, was ich seitdem von Roderick gesehen hatte – seine beinahe obsessive Konzentration auf die Arbeit, die gelegentlichen Anfälle von Gereiztheit und Ungeduld –, schien es mir offensichtlich, dass seine Probleme noch nicht gänzlich gelöst waren.
Ich sagte: »Das tut mir leid. Der arme Rod. Und es tut mir auch leid für Sie und Caroline! Aber wissen Sie, ich habe schon viele Kriegsverletzte behandelt …«
»Natürlich«, räumte sie hastig ein. »Ich weiß, dass Roderick noch viel Schlimmeres hätte passieren können.«
»Das meine ich gar nicht«, sagte ich. »Ich habe an den Heilungsprozess gedacht, daran, wie unvorhersehbar er sich oft entwickelt. Bei jedem Patienten verläuft er anders. Es ist doch eigentlich kaum verwunderlich, dass Rodericks Verletzung ihn zornig gemacht hat. Ein junger, gesunder Kerl wie er? Ich in Rods Alter und in einer solchen Situation wäre ebenso zornig gewesen. Wenn man so viel Gutes besitzt und dann plötzlich so viel verliert: die Gesundheit, das gute Aussehen – ja, in gewisser Weise sogar die Freiheit.«
Sie schüttelte ohne große Überzeugung den Kopf. »Es war mehr als reiner Zorn. Es war, als hätte der Krieg selbst ihn verändert, einen vollkommen anderen Menschen aus ihm gemacht. Er schien sich selbst und auch alle
Weitere Kostenlose Bücher