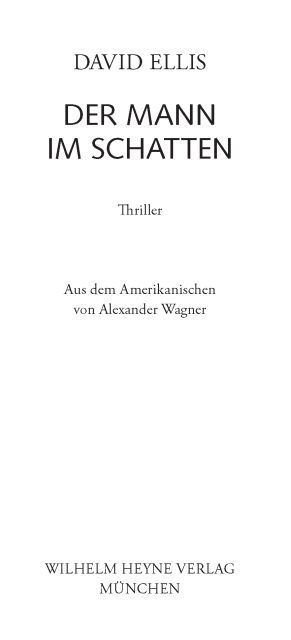![Der Mann im Schatten - Thriller]()
Der Mann im Schatten - Thriller
schrägen Stellplatz einparkte. Dann klappte ich mein Handy auf, wählte die Nummer, drückte aber noch nicht auf Senden. Die Wagentür öffnete sich, und
ich straffte mich, das Handy fest in der Hand. Schritte ertönten, doch noch konnte ich niemanden sehen. Ich hörte, wie der Kofferraum aufsprang. Ein Augenblick verging, vielleicht hob er die Abdeckung über dem Reserverad, um seinen Drogenvorrat herauszuholen, aber der Regen fiel zu heftig, um irgendetwas davon mitzubekommen.
Ich drückte auf Senden, sobald er in mein Blickfeld trat, nur ein paar Meter von der Hintertür entfernt, den Blick von mir abgewandt. Dann drückte ich die Stummtaste.
»Was soll der Scheiß«, fluchte er, als er die Essensreste direkt vor dem Eingang entdeckte. Abrupt bremste er den schnellen Trab ab, mit dem er sich vor dem Regen in Sicherheit bringen wollte. Jetzt klingelte sein Handy. Er griff nach dem Telefon an seinem Gürtel, ohne zu bemerken, dass der Anrufer nur wenige Meter links von ihm kauerte.
Er starrte auf das Display, vermutlich um die Anruferkennung zu kontrollieren. Dann klappte er das Handy auf. »Ja?« Während er weiter in das Telefon sprach - »Hallo? Hal- lo? « -, streckte er sein linkes Bein aus, um das Essen aus dem Weg zu schieben.
Ich hatte die Klinke eingeschmiert, um zusätzlich Zeit zu gewinnen, was nun aber gar nicht mehr nötig war. Dies war der richtige Moment. Er war abgelenkt, balancierte leicht schwankend auf einem Bein und presste mit einer Hand sein Telefon ans Ohr.
Das weiße Rauschen des Regens, der auf den Asphalt klatschte, übertönte meinen kurzen Sprint. Ich war bei ihm, bevor er mich bemerkte. Ich sprang ihn an, wie ein Verteidiger einen Trainingssandsack attackiert, allerdings ohne befürchten zu müssen, für einen regelwidrigen Block ermahnt zu werden.
Er war ein Leichtgewicht, und er sah mich nicht kommen.
Er flog durch die Luft, prallte gegen die Ziegelmauer neben der Tür, sein Handy segelte davon, und sein Kopf krachte mit einem üblen Geräusch gegen die Ziegel. Für einen Moment befürchtete ich, ihn zu hart erwischt zu haben, aber das Geräusch aus seinem Mund, eine Mischung aus Schock und Schmerz, verriet mir, dass noch ausreichend Leben in ihm steckte.
Bevor er wieder halbwegs durchblickte, hatte ich meinen Revolver gezogen und ließ ihn daran schnuppern, während ich mit der anderen seine Haare packte.
»Ich hab dich schon gesucht, J.D.«, sagte ich.
32
John Dixon brauchte gut eine Minute, bevor er antwortete. Sein Kopf war heftig gegen die Ziegelwand geknallt. Seine rechte obere Wange war zerkratzt, und sein Ohr blutete. Er war so gelandet, dass er nicht mehr unter der Markise lag, und der Regen prasselte ihm direkt ins Gesicht. Für meinen Geschmack unterstrich dieses Detail noch die düstere Gesamtatmosphäre, und da mir selbst die durchweichten Kleider am Leib klebten, kümmerte es mich herzlich wenig.
Seine Augen zwinkerten hektisch, kämpften gegen den Regen an, womöglich auch gegen die Folgen einer Gehirnerschütterung. Schätzungsweise war ihm übel, und wenn man kurz davor ist, zu kotzen, ist es nicht sehr angenehm, rücklings dazuliegen, während gleichzeitig jemand auf deiner
Brust hockt und deine Arme mit den Knien auf den Boden presst.
All das in Betracht gezogen, begann dieser noch jungfräuliche Tag alles andere als erbaulich für J.D.
»Nimm’s dir einfach... nimm’s schon«, stöhnte er. Er konnte mich nicht fixieren, da er direkt hinauf in den strömenden Regen blickte, außerdem war er vermutlich erfahren genug, um zu wissen, dass man seinem Angreifer nie allzu lange ins Gesicht starren soll, besonders, wenn dieser bewaffnet ist. Als Staatsanwalt hatte ich erfahren, dass viele Opfer es ganz bewusst vermieden, ihrem Angreifer in die Augen zu sehen. So waren sie nicht in der Lage, den Täter zu identifizieren, und konnten hoffen, dadurch weniger bedrohlich zu wirken und ihre Überlebenschancen zu erhöhen.
Ich neigte mich so nahe an sein Gesicht heran, wie es die Umstände erlaubten, und presste den Revolver noch fester gegen seine Nase. »Ich will deine Scheißdrogen nicht, J.D.«
»Wie, zum Teufel, haben Sie mich gefunden?«
Es war überraschend einfach gewesen. Ich war davon ausgegangen, dass ein Drogendealer, der bereits seinen Tagesjob schwänzte, nicht auch noch seine nächtlichen Unternehmungen aufgab, egal, wie gut er für sein Untertauchen bezahlt wurde. Weder wollte er auf das Geld verzichten, noch wollte er zulassen, dass seine Kunden
Weitere Kostenlose Bücher