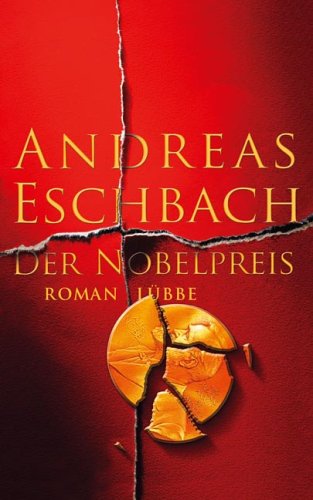![Der Nobelpreis]()
Der Nobelpreis
damit, die roten Kästen mit den aufgerollten Löschwasserschläuchen an den Wänden anzustarren.
Eine stadtauswärts fahrende Tunnelbana Richtung Skarpnäk kam herein, mäßig besetzt, und hielt. Ich betrachtete die Leute, die darin saßen. Verhärmt dreinblickende, mit offenem Mund dösende, gelangweilt aussehende, sich unterhaltende …
Na so ein Zufall. Da saß die Blondine, die mir in Hungerbühls Haus aufgefallen war. Die Frau mit der hellen, unglaublichen Mähne. Sie war es, kein Zweifel. Sie hielt die Hände eines Mannes, der ihr gegenübersaß, sprach lebhaft auf ihn ein, schien regelrecht angetörnt zu sein.
Das Signal ertönte, die Türen schlossen sich krachend. Die Bahn fuhr an. Ich trat zwei Schritte näher, weil mich jetzt doch interessierte, wie ein Typ aussah, der eine solche Frau antörnen konnte.
Im Vorbeifahren erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Zu meiner maßlosen Verblüffung kannte ich den Mann. Mehr noch, ich hätte ihn auch unter weit ungünstigeren Umständen überall und jederzeit wiedererkannt.
Es war Per Fahlander.
Ich konnte es nicht glauben. Mein Betreuungshelfer, der sich einst in Alkohol förmlich konserviert hatte? Stimmt, er wohnte in Björkhagen, aber … aber wie kam er zu so einer Freundin? Oder Geliebten, oder was auch immer? Ich kannte ihn nur als Mönch, als einzig dem Rausch ergebenen Asketen.
Hatte ich wirklich gesehen, was ich gesehen hatte? Ich starrte den dunklen Schacht an, in dem die Waggons verschwunden waren, und fand keine Antwort.
Mit metallischem Kreischen fuhr meine Bahn ein. Ich ging auf eine der Türen zu, doch ehe ich sie erreichte, wurde sie von innen geöffnet. Leute kamen heraus. Im Hintergrund stand ein Mädchen mit langen, blonden Haaren, das vierzehn, fünfzehn Jahre alt sein mochte und ein besticktes Stirnband trug. Sie sah aus wie Kristina, zumindest für einen Augenblick, lange genug, um mich erstarren zu lassen. Dann wandte sie den Kopf, und ich sah, dass es nicht Kristina war, natürlich nicht, aber ich konnte nicht mehr einsteigen.
Nein. Ich durfte keine Zeit mehr vergeuden. Ich musste handeln, jetzt, sofort.
Eine Viertelstunde später saß ich in meinem Auto und war unterwegs nach Vaxholm.
Früher hatten mich Aufträge bisweilen in andere Länder geführt, und dort hatte ich in Wohngebieten größere und prunkvollere Villen gesehen, doch für schwedische Verhältnisse war Bosse Nordins Haus ohne Zweifel ein Palast. Obwohl man von der Straße aus wenig sah, weil das meiste hinter hohen, dichten, immergrünen Büschen versteckt war, schrie das gesamte Anwesen deutlich hinaus, dass hier Geld! Geld! Geld! war, und zwar richtig viel davon.
Das war nicht das Heim eines Universitätsprofessors, so viel stand fest.
Ich fuhr die Straße einmal ab und parkte schließlich in der dunkelsten Ecke, die ich finden konnte: Unnötig, dass eventuelle Passanten meine Nummernschilder lasen. Dann stieg ich aus, blieb erst einmal stehen und lauschte.
Nichts. Die Straße lag leer und verlassen. Es war kalt, wenn auch nicht mehr ganz so schneidend wie in Stockholm, und es roch nach Meer.
Ich schlug den Kragen meiner Jacke hoch und setzte mich langsam in Bewegung, am Zaun des Nordin’schen Anwesens entlang. In dem dunklen Garten jenseits der Hecke standen Spielgeräte, eine Schaukel, eine Rutsche und ein schwarzes Etwas, das ein Sandkasten sein mochte. Alles sauber aufgeräumt, verlassen, seit Jahren verwaist. Auf den Pfosten der Hofeinfahrt prangten steinerne chinesische Löwen mit drohend aufgerissenen Mäulern, und von der völlig im Dunkeln liegenden Haustür her war das Klingeln eines Windspiels zu vernehmen. Auf dem Briefkasten stand Nordin, sonst nichts.
Ich sicherte nach allen Seiten, tat, als suche ich etwas in meinen Taschen. Niemand, der mich beobachtete. Auch die übrigen Häuser dieser Gegend, kaum weniger beeindruckend, schienen leer und verlassen. Eine Geisterstraße. Kein Problem, hier noch ein bisschen zu stehen und nach Zugängen und Fluchtwegen Ausschau zu halten.
Die Dunkelheit war in dieser Hinsicht schon eher ein Problem. Ich sah von der Straße aus nicht einmal bis zur Haustüre, konnte nicht einmal erkennen, ob die Fenster vergittert waren oder nicht. Es wäre nur vernünftig gewesen, morgen früh wiederzukommen, irgendwann in der kurzen Zeitspanne, in der sich die winterliche Sonne am Himmel blicken ließ.
Doch mir war nicht vernünftig zumute. Ich war hier, und wozu eigentlich sollte ich warten? Warum nicht handeln,
Weitere Kostenlose Bücher