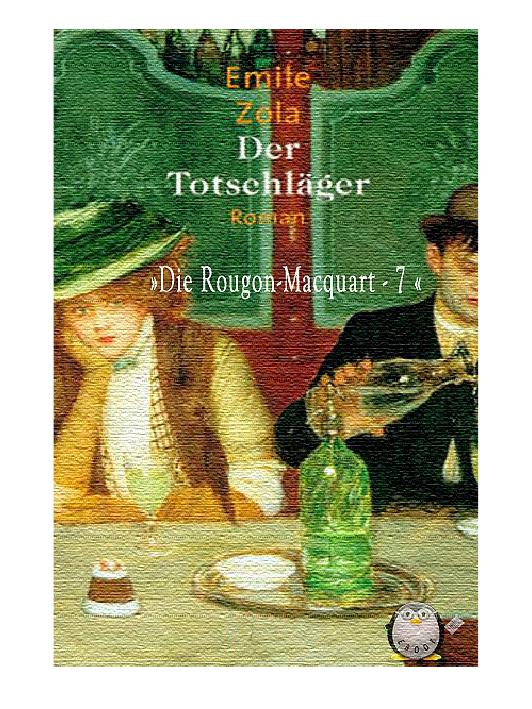![Der Todschlaeger]()
Der Todschlaeger
Vorstädte und
nicht eine mit Rosenwasser parfümierte
Sprache sprechen zu lassen.
Zola selbst aber führte wissenschaftliche
Argumente für seinen Versuch ins Feld. Wenn
es den Philologen erlaubt war, in diesem
Großstadtargot herumzuspüren, wenn es sogar
eigene Wörterbücher dieser Sprache gab, wer
wollte dem Schriftsteller dann das Recht
streitig machen, die literarische Neugier zu
haben, »die Sprache des Volkes zu sammeln
und in eine gut ausgearbeitete Form zu
gießen«? Auch hier habe niemand erkannt, daß
es sein »Wille war, eine rein philologische
Arbeit zu leisten«, von der er glaubte, »daß sie
von lebhaftem historischem und sozialem
Interesse ist«. Und in einem Brief an Albert
Millaud vom 3.9.1876 bezeichnet er den Stil
des »Totschlägers« geradezu als »eine
philologische Studie«. Die Philologen als
Kronzeugen aufzurufen war ein etwas
gewagtes Spiel, denn philologisch unter die
Lupe genommen, ergaben sich im Wortschatz
dieses Romans doch einige ganz beachtliche
Anachronismen, erschien so mancher
Ausdruck nicht mehr »kernig« und
»waschecht«, sondern recht papieren und allzu
»philologisch«. Im Grunde aber waren diese
Ausstellungen genauso kleinlich, wie Zolas
philologisches Versteckspiel unnötig war. Man
hatte sich vor allem an dem Titelwort
»Totschläger« (assommoir) gestoßen, weil in
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
eine Kneipe mit »bistro« bezeichnet wurde,
»assommoir« dagegen schon seit ungefähr
dreißig Jahren veraltet war. Ursprünglich hatte
»assommoir« von »assommer« (erschlagen)
um 1700 abgeleitet, einen Schlagstock
bezeichnet, mit dem man jemanden »zu Tode
bringen« konnte. Um diese symbolisch
eingesetzte Doppelbedeutung ging es aber
Zola. Für die Kritik jedoch schien er in
laienhafter Unkenntnis auf seine
Gewährsmänner hereingefallen zu sein. Denn
es war natürlich bekannt, daß er sich in seiner
üblichen Gewissenhaftigkeit nicht mit dem aus
dem eigenen Erleben geschöpften Wissen und
eigenen Kenntnissen zufriedengegeben,
sondern einige Spezialwerke konsultiert hatte:
einen Sammelband reportageartiger Berichte
über das Pariser Arbeiterleben von Denis
Poulot aus dem Jahre 1870 und das 1866
erschienene Argotwörterbuch von Delvau. Aus
beiden hatte er Auszüge gemacht und nach
Sachgebieten zusammengestellte Wortlisten
angelegt, die er bei der Abfassung der
einzelnen Kapitel nochmals durchging und auf
denen er die verwendeten Wörter dann
abstrich. So stammen z.B. auch die
Spitznamen von Coupeau, von Coupeaus
Freunden und von Goujet aus Poulots Buch.
Und es war auch durchaus möglich, daß der
eine oder der andere Ausdruck nicht mehr
aktuell war. Das heißt, wann aktuell? Als Zola
den Roman schrieb (1875/76), als er ihn
beginnen ließ (1850) oder zum Zeitpunkt
seines Endes (1865)? Da lag die wirkliche
Schwierigkeit, denn der typische Wortschatz
des Großstadtargots wandelt sich ungemein
rasch. Die Differenz zwischen dem Beginn der
Romanhandlung und der Abfassungszeit
betrug jedoch mehr als eine Generation, und
selbst innerhalb des Zeitraums von fünfzehn
Jahren, in dem der Roman spielt, hätten dann
die Veränderungen festgehalten werden
müssen. So ist es nicht verwunderlich, daß
sich manches den Bewohnern der Vorstädte
abgelauschte Kraftwort mit einem längst
verdorrten Relikt aus Delvau oder Poulot
zusammenfand. Wenn man z.B. bedenkt, daß
die heutige Berliner Jugend das mit »schau«
bezeichnet, wofür ihre Eltern »knorke« und
ihre Großeltern »schnafte« und »schnieke«
sagten, so kann man ungefähr ermessen,
welche Schwierigkeiten Zola für die Sprache
des »Totschlägers« entstanden und vor welche
ebenfalls fast unlösbaren Schwierigkeiten sich
auch der Übersetzer gestellt sieht. Denn Zola
hat, ungeachtet aller Anachronismen und
möglichen Schiefheiten, Pariser Argot
verwendet, also die spezielle Sprache des
Volkes der französischen Hauptstadt. Soll man
dies mit Berliner Dialekt wiedergeben, dem
Dialekt unserer Tage oder dem der sechziger
und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,
oder soll man vielleicht, doch eine mehr
allgemein gehaltene und folglich auch
zeitlosere dialektale Form wählen? Wir haben
versucht, letzteren Weg zu gehen, und waren
uns dabei der Tatsache wohl bewußt, daß wir
damit in einem gewissen Sinne verbiegen, im
anderen aber vielleicht doch der Absicht des
Autors und auch der Wirkungsmöglichkeit des
Buches
Weitere Kostenlose Bücher