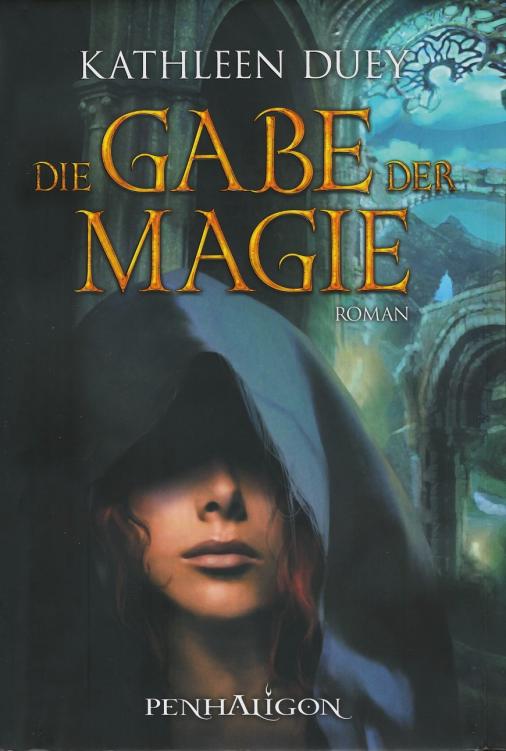![Die Gabe der Magie]()
Die Gabe der Magie
sie es bei ihren Ziegen und bei Shy getan
hatte.
Franklin?
»Warte auf mich«, rief er zurück, ohne
aufzublicken. Dann drehte er sich zurück zu seiner Kundin.
Sadima schauderte. Es hatte funktioniert.
Oder doch nicht? Vielleicht hatte er auch nur zufällig zu ihr aufgesehen. Sie
starrte ihn an und formte in Gedanken noch einmal seinen Namen. Er unterbrach
sein Gespräch mit der Frau nicht.
Als Sadima weiterschlenderte und die
Menschenmenge beobachtete, die sich über den Marktplatz schob, fiel ihr eine
edle Kutsche auf, und sie erkannte die Frau wieder, die steif auf der
gepolsterten Samtbank saß.
Kary Blae. Das dunkle Holz der Kutsche
wirkte gar nicht mehr so beeindruckend, nun, da Sadima inzwischen so viele
ähnliche Kutschen gesehen hatte. Aber sie war trotzdem prachtvoll. Dieses Mal
zog ein anderes Pferdegespann das Gefährt. Es waren zwei glänzend schwarze
Stuten mit langen Mähnen, die perfekt zueinander passten. Kary Blae winkte, und
Sadima erwiderte den Gruß, erstaunt darüber, dass sich die Frau an sie
erinnerte.
»Sadima?« Sie drehte sich um. Franklin
lief lächelnd auf sie zu. »Was führt dich auf diese Seite des Marktplatzes?«
Sie errötete, konnte ihm aber nicht die
Wahrheit sagen. Wenn Somiss jemals herausfände, dass sie sich selbst das Lesen
beibrachte, würde er außer sich vor Zorn sein. Sie schüttelte den Kopf und
zwang sich, ausschließlich darüber nachzusinnen, wie kalt und auch ein wenig
hungrig sie sich fühlte, nur für den Fall, dass Franklin versuchte, ihre
Gedanken zu belauschen. »Ich habe angefangen, verschiedene Wege zu nehmen. Die
Bettler wissen inzwischen, dass ich ein weiches Herz für sie habe.«
Franklin nickte. »Ich gebe ihnen auch hin
und wieder etwas. Pass nur auf, dass Somiss niemals davon erfährt.«
Sadima seufzte. »Würde er wirklich so
missgünstig sein, nur wegen eines halben Kupferstücks hier und da?«
Franklin nickte. »Was mich betrifft, auf
jeden Fall. Bei dir weiß ich es nicht genau. Wahrscheinlich. Er glaubt, alles, was wir verdienen, gehöre ihm, damit er es
für sei ne Arbeit verwenden kann.«
Sadima spürte, wie ihre Haut prickelte,
aber sie nickte und schaute Franklin fest ins Gesicht. Er sah müde aus. Sie setzte
sich wieder in Bewegung, und er lief neben ihr her. Kurze Zeit darauf beugte er
sich zu ihr und flüsterte: »Hast du heute Abend irgendwelche Wachen gesehen?«
Sadima warf ihm einen Blick zu. »Ich
glaube nicht. Wie sehen sie denn aus?«
Franklin machte eine Geste und hob eine
Hand über seinen Kopf. »Es sind große Männer mit dunklen Tuniken und Helmen aus
poliertem Nickel. Sie tragen Stäbe und haben Schwerter umgehängt.«
Sadima schüttelte den Kopf. »Nein, ich
habe niemanden auf der Straße gesehen, auf den diese Beschreibung passt. Warum
auch?«
Franklin schaute sich um. »Somiss sagt,
der König hätte Wachen ausgesandt, um nach ihm zu suchen.«
Etwas in seiner Stimme verriet Sadima,
dass er diese Aussage bezweifelte. »Stimmt das?«, fragte sie.
Franklin zuckte die Schultern. »Sein Vater
hasst, was er tut, und …«
»Das sagt Somiss«, unterbrach ihn Sadima
verärgert. War es denn für sie beide unmöglich, sich mal einen Moment lang zu
unterhalten, ohne über Somiss zu sprechen?
Franklin runzelte die Stirn, und sie
wandte den Blick ab.
Als sie aus dem Schatten der Bäume traten
und auf dem Bürgersteig spazierten, liefen sie schweigend nebeneinander her.
Sadima sah, dass die Balkontüren ein Stückchen
geöffnet waren. Im Innern brannte eine Lampe. Arbeitete Somiss am Tisch?
Dann würde es keine Gelegenheit geben, Franklin von den zusätzlichen Münzen zu
berichten. Nicht heute Abend jedenfalls.
Sie überquerten die Straße mit dem
Kopfsteinpflaster, und als Franklin ihr die Tür aufhielt, fiel ihr auf, dass
seine Hand zitterte. Glaubte er Somiss und fürchtete sich vor den Wachen?
»Franklin«, begann sie, doch zornige
Schreie schnitten ihr das Wort ab. Sie drehte sich um. Ein Junge von vielleicht
zehn oder elf Jahren kam die Treppe heruntergerannt; Blut lief aus seinem Mund
durch die Finger seiner rechten Hand hindurch, die er schützend vors Gesicht
hielt. Er strauchelte, als er die letzten drei Stufen hinuntersprang, doch
irgendwie gelang es ihm, auf den Beinen zu bleiben. Franklin griff nach ihm,
drehte ihn zu sich herum und fragte ihn, was denn passiert sei, doch der Junge
riss sich los und rannte weiter, rutschte über den Steinboden und wäre wieder
beinahe gestürzt, als er in die Straße
Weitere Kostenlose Bücher