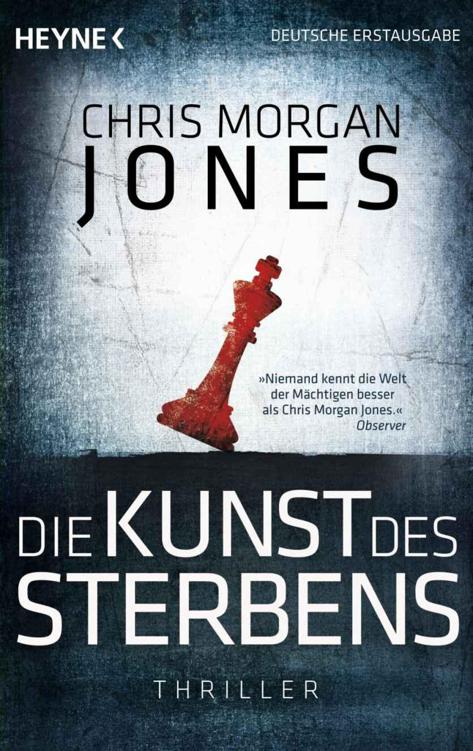![Die Kunst des Sterbens: Thriller (German Edition)]()
Die Kunst des Sterbens: Thriller (German Edition)
bei ihm sei, und Webster dann alleine gelassen, der den Inhalt einer Glasvitrine betrachtet hatte. Darin befanden sich alle möglichen Artefakte: einzelne Seiten alter Koranausgaben, deren Ränder braun und ausgefranst waren; eine Flasche aus funkelndem blauem Glas; eine längliche, schmale Lackschatulle, auf deren Seite ein Liebespaar in einem Obstgarten gemalt war; ein Keramiklöwe, türkisfarben, dessen Augen und Maul so abgewetzt waren, dass mannur einen schwachen Eindruck seiner ursprünglichen Wirkung bekam; und ein Dolch mit funkelnder, glitzernd scharfer Klinge, dessen Griff aus Gold gefertigt und mit arabischen Inschriften versehen war.
Qazai hatte Webster gerade lang genug warten lassen, um ihn daran zu erinnern, wer von ihnen beiden der Klient war, allerdings nicht so lange, dass es unhöflich war. Zu Websters Erleichterung kam er alleine; offensichtlich spielte Senechal diesmal nicht den Aufpasser. Qazai trug einen Zweireiher aus feiner marineblauer Wolle mit zarten Streifen, ein weißes Hemd und eine Krawatte im dunkelsten Grün. Sein Auftreten war genauso elegant wie auf dem Gedenkgottesdienst für Mehr. Er hatte sich nach Hammer erkundigt, nach Ikertu und nach Websters Familie, und bevor er ihn zu einem der Sofas geleitete, hatte er ihm zu jedem Stück in der Vitrine etwas erzählt. Welches wohl das wertvollste sei, hatte er von Webster wissen wollen und schien zufrieden, als dieser – er verstand, worauf das Spielchen hinauslief – richtigerweise auf das unscheinbarste Stück tippte, den Teil einer Koranausgabe, der durch seine fast vierzehnhundert Jahre dauernde Reise von der Arabischen Halbinsel hierher so gelitten hatte, dass die Seiten hauchdünn waren.
Webster und sein Team arbeiteten seit einer Woche an dem Fall. Viel hatten sie bisher nicht herausgefunden, doch bevor sie weiterrecherchierten, wollte Webster Qazai so viele Fragen wie möglich stellen – über den Diebstahl des Reliefs, über Shokhor und vor allem über Mehr, dessen Tod nun womöglich eine ganz neue Bedeutung bekam. Er rechnete nicht damit, dass die Antworten Licht ins Dunkel bringen würden, trotzdem wollte er sie zu Protokoll nehmen; je mehr Qazai gezwungen war, jetzt zu erzählen, desto größer war die Chance, dass man ihn später der Lüge überführte.
Zunächst befragte er ihn zu seiner Vergangenheit, zur Geschichte seiner Firma und zu seinen Investoren – um die Zusammenhänge zu verstehen, so hatte er erklärt, um die Aussagekraft seiner Untersuchungsergebnisse einschätzen zu können, doch eigentlich dienten die Fragen dazu, Qazai in Sicherheit zu wiegen und ihn vielleicht auf dem falschen Fuß zu erwischen. Qazai hatte genickt und erklärt, er könne ihn fragen, was immer er wolle. Und Webster interviewte ihn zu seinem Vater, zur Gründung der Firma, zu ihrer Finanzierung und ihren ersten Kunden. Jede seiner Antworten klang akkurat, umfassend und glaubwürdig, und, da er das alles schon oft erzählt hatte, routiniert und so stimmig, dass es Webster nicht wirklich störte, als Senechal schließlich zu ihnen stieß. Keine Frage, Qazai war in der Lage, auf sich selbst aufzupassen.
Er erzählte von seiner Kunst – von seiner Sammlung, der Stiftung, seiner Freundschaft zu Mehr – und von seiner Familie, vor allem von Timur, seinem Sohn, der diesen gewaltigen Besitz einmal erben würde. Webster sank in das große Sofa zurück und machte sich auf den Knien umständlich Notizen. Sosehr er sich auch bemühte, er schaffte es nicht, Qazai aus dem Konzept zu bringen. Er konnte keinerlei Widersprüche, keinerlei Unstimmigkeiten entdecken.
Es machte Qazai nichts aus, auf diese Weise von sich zu erzählen. Ja, es war offensichtlich, dass er das schon oft getan hatte, zumindest wenn man danach ging, wie lückenlos seine Schilderung klang. Eine Episode führte nahtlos zur nächsten, und Senechal, der keinen Grund hatte zu unterbrechen, saß unnatürlich aufrecht auf dem Sofa und tippte bloß etwas in sein BlackBerry, machte sich Notizen oder schrieb E-Mails, während er mit einem Ohr seinem Chef lauschte, dessen Eigendarstellung gleichzeitig zurückhaltend und selbstgefällig war. Egal ob er erzählte, wie gerissen sein Vater oder wie brillant sein Sohn war, es ging dabei immer um ihn selbst: Ohne seinen Vater, seine Mitarbeiter oder seinen Sohn sei er nichts. Und obwohl er es nicht aussprach, konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie ohne ihn sehr viel weniger wären.
Er neigte dazu, bei jeder Gelegenheit
Weitere Kostenlose Bücher