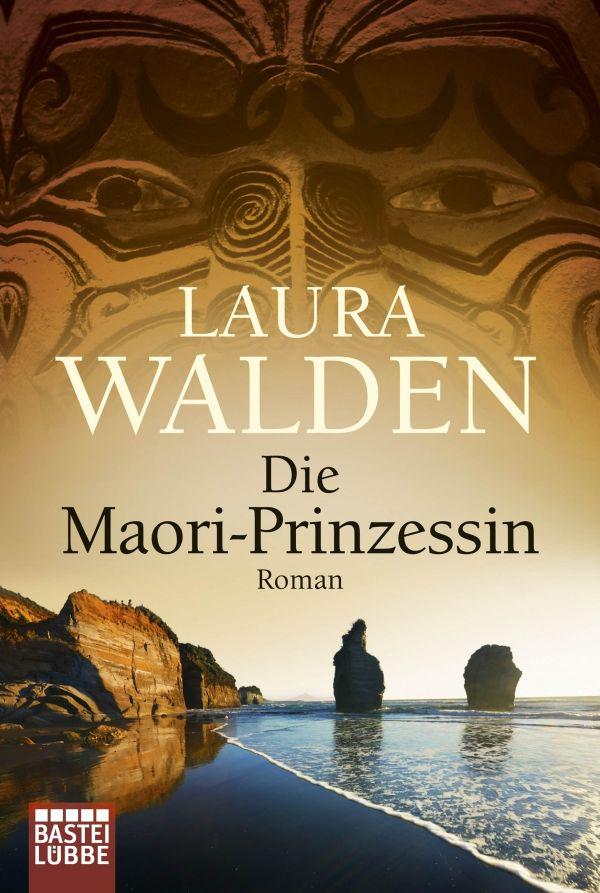![Die Maori-Prinzessin]()
Die Maori-Prinzessin
an: »Das ist etwas für starke Männer und andere Helfer. Wir sind nicht zum Bergen gekommen, sondern nur für die Behandlung der Wunden der Geretteten!«
»Wo sind die Verletzten?«, brüllte sein Kollege dem Mann zu.
»Im Park!«, schrie er.
Sie rannten die Straße entlang über Schutt, um zerstörte Wagen herum. Sie mussten über eine umgekippte Straßenbahn klettern.
Plötzlich in einer Seitenstraße blieb Hariata stehen.
»In dem Haus wohnt meine Familie«, schrie sie. »Warum löscht es denn keiner?«
»Weil wir kein Wasser haben!«, brüllte ein Feuerwehrmann zurück. »Weil wir kein verdammtes Wasser haben!«
Eva konnte Hariata gerade noch davon abhalten, in das brennende Haus zu stürmen. »Sei vernünftig. Vielleicht ist deine Familie längst gerettet.«
Die Maori zögerte zunächst, doch dann folgte sie Eva und den beiden Ärzten. Im Park sah es aus wie in einem Lazarett. Jedenfalls stellte sich Eva das so vor. Ihr Vater hatte nämlich oft geschildert, wie es im Krieg zugegangen war. Aber nur, wenn er zu viel von dem Wein getrunken hatte, dann hatte er mit Tränen in den Augen geschildert, was er in Verdun gesehen hatte. Schreiende Fleischbündel, Reste von Menschen …
Sie teilten sich in zwei Gruppen. Eva ging mit dem einen, Hariata mit dem anderen Arzt.
Vor ihnen auf der Erde lag ein sich vor Schmerz aufbäumender Mann, dem die Hand fehlte und dessen blutiger Stumpf versorgt werden musste. Wieder fielen Eva die Worte ihres Vaters ein.
Nicht daran denken!, ermahnte sie sich und versuchte, all ihre Gefühlte auszuschalten, während sie den Anweisungen des Arztes folgte. Ohne nachzudenken, reichte sie ihm aus seiner Tasche, wonach er verlangte, zerriss Hemden der Männer in Fetzen und machte daraus Verbände.
Sie zuckte zusammen, als der Arzt sich plötzlich ihr zuwendete und sie bat stillzuhalten. Dann betupfte er ihre Stirn mit einer teuflisch brennenden Lotion und wickelte ihr einen Verband um den Kopf.
»Es hat stark nachgeblutet«, erklärte der Arzt. »Sie müssen die Wunde vor Keimen schützen.« Er wandte sich nun wieder den stöhnenden Verletzten zu. Einige hatten nur Knochenbrüche erlitten. Die schrien am lautesten, doch sie wurden nach Anweisung des Arztes erst zum Schluss versorgt.
»Halten Sie durch!«, ermutigte er eine Frau, die kaum einen Ton von sich gab. »Das tut höllisch weh, aber hier geht es um Leben und Tod!« Dann wandte er sich an Eva.
»Ich brauche ein sauberes Tuch und Jod.«
Eva beeilte sich und hielt ihm beides hin. Dann fiel ihr Blick auf die verwundete Frau. Sie biss die Zähne zusammen, denn ihr Gesicht, das der Arzt in diesem Augenblick zu retten versuchte, war bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Es war nur noch eine einzige blutende Wunde. Und doch ahnte Eva, wem es gehörte. Sie versuchte, ihre Ahnung wegzuschieben.
»Sie müssen ihren Kopf halten«, brüllte der Arzt. »Ich muss das Blut wegwischen. Sonst kann ich nicht sehen, was …« Er nahm das Tuch, das Eva ihm gereicht hatte, und begann die rote zähe Masse zu entfernen. Eva hielt tapfer ihren Kopf und versuchte nicht in die blutende Wunde, die einmal ein Gesicht gewesen war, zu sehen. Plötzlich wurde das Stöhnen der Frau lauter. Und dann redete sie. »Wo bin ich? Wo bin ich?«, wiederholte sie ein paar Mal. Eva strich ihr vorsichtig über die unversehrte Stirn, immer noch bemüht, sie nicht anzugucken.
»Wo ist Adrian, wo ist Berenice?«, wiederholte die Frau in diesem Moment verzweifelt. Jetzt konnte Eva nicht anders. Sie musste sich dem Grauen stellen. Ihr wurde übel. Es war nicht länger zu leugnen: Das zerschundene Gesicht und der blutende Schädel gehörten Tante Joanne! Sie aber gab sich nicht zu erkennen. Zu sehr war sie damit beschäftigt, gegen die Übelkeit anzukämpfen. In diesem Augenblick, in dem das Entsetzliche ein Gesicht hatte. Denn nachdem der Arzt das Blut weggewischt hatte, sah es bis auf Schrammen und Schnittwunden wieder menschlicher aus. Zu Evas Erleichterung hielt Tante Joanne die Augen geschlossen.
Der Arzt deutete stumm auf Tante Joannes Schädel, in dem ein Riesenloch klaffte, und schüttelte unmerklich den Kopf. Eva verstand. Er konnte nichts mehr für die Patientin tun.
»Bitte bleiben Sie bei ihr, halten Sie ihre Hand. Es wird nicht mehr lange dauern«, flüsterte er. Eva atmete ein paar Mal tief durch. Was würde sie darum geben, wenn dies eine Fremde wäre, aber das konnte sie sich nicht aussuchen. Tante Joanne war beim Friseur in der Emerson Street gewesen.
Weitere Kostenlose Bücher