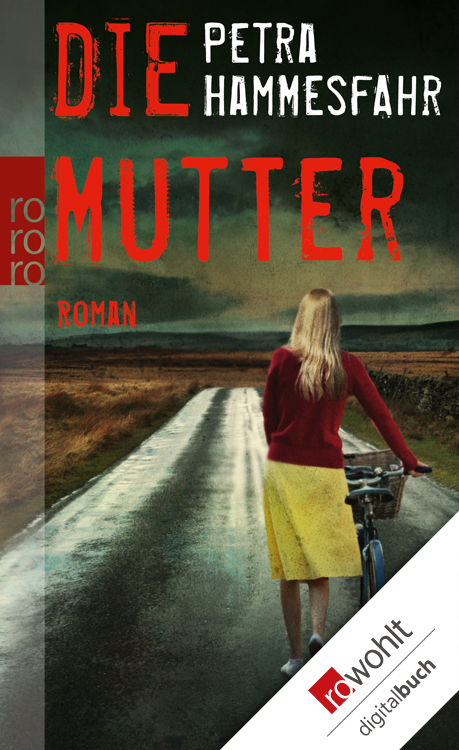![Die Mutter]()
Die Mutter
zu sehen; wenn ich mir wenigstens hätte sagen können: «Das musste passieren, Vera. Du hast ihn seit Wochen nicht an dich herangelassen. Und ab und zu braucht er es eben.» Vielleicht wäre mir leichter geworden. Nur konnte ich mir das nicht sagen, weil er gesagt hatte: «Ich kann nicht.» Und wenn er nicht wollte oder konnte, rührte sich nichts. Nach Renas Geburt hatten wir fast ein Jahr wie Bruder und Schwester gelebt.
Es tat weh, so entsetzlich weh. Nicht, dass er mich seit langem mit diesem Miststück betrogen, nur, was er ihr anvertraut hatte. Es machte rasend, es machte verrückt und es machte hilflos. Weil es die Wahrheit war. Und was er vorher gesagt hatte über Vater und einen Kerl, der sich den Arsch aufriss, der bei uns Verständnis und Verzeihung suchte …
Ich weiß nicht, wie ich hinunter ins Auto kam und zurück auf den Hof. Ich habe nicht einen Baum gesehen am Straßenrand, nicht eine Kurve bewusst genommen. Ich habe in der Stadt keine Ampeln gesehen, keine Fußgängerüberwege und auf der Landstraße keine anderen Fahrzeuge, auch nicht die Pfosten der Einfahrt oder das Scheunentor. Nur Rena in seinen Armen.
Wie er damals mit ihr ins Wohnzimmer kam. Wie er bei der Tür stehen blieb, wie sein Blick zwischen dem Fernseher und meinem Gesicht hin und her schweifte. Dann schaute er auf Rena und sagte: «Ich werde sie dann mal baden. Soll ich sie auch gleich ersäufen oder meinst du, du packst es morgen irgendwie, wenn sie wieder spuckt?»
Ich kam ins Haus, Gretchen saß in der Küche vor einer Kaffeetasse und einer Zeitschrift. Sie schaute auf, zeigte auf die Kaffeemaschine.«Ich hab’s mal probiert. Ich hoffe, du hast nix dagegen, dass ich mich bedient …» Sie brach ab und fragte: «Was ist passiert? Du siehst aus wie ein Geist.»
«Er geht fremd! Mit einer Patientin.» An jedem weiteren Wort wäre ich erstickt.
Sie brauchte zwei Sekunden, um den Sinn meiner Worte zu erfassen. Dann meinte sie trocken: «Da soll er mal aufpassen, dass die ihn nicht eines Tages drankriegt. Eine Patientin! Ich hätte ihn für vernünftiger gehalten.»
Kein Bedauern, kein Trost, kein Wort über verletzte Gefühle, nur die rein praktische Seite und der obligatorische Schnaps. Ich kippte ihn und ging in die Diele, um Heinz Steinschneider anzurufen. An etwas anderes konnte ich nicht denken.
Etwas in meinem Hirn hatte abgeschaltet. Ich war leer, belogen, betrogen, in Watte gepackt und allein gelassen worden, an einem Punkt angelangt, von dem ich nicht einmal gewusst hatte, dass er existierte.
Ich griff nach dem Telefonhörer. Gretchen hielt mich am Arm zurück. «Moment! Hör lieber erst mal in das Ding da rein.»
Ihr Blick und ihre Stimme spiegelten Unbehagen und einen Hauch von Furcht. «Es hat einer angerufen. Ich hab abgenommen, wie du gesagt hast. Aber als ich mich gemeldet hab, kam nicht mehr viel.»
10. Kapitel
Ich konnte das Band nicht sofort abhören. Ich musste zuerst telefonieren. «Einer» hatte Gretchen gesagt. Und Vater sagte: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mann war.» Jürgen sprach von einem Kerl. Mutter erwähnte Klinkhammers Interesse an der schüchternen Stimme einer älteren Frau. Und diese schüchterne ältere Frau rief: «Wo bleibst du denn?» Oder: «Was machst du denn?» Und ein junger Mann sagte: «Es tut mir Leid. Es tut mir Leid. Ich wollte sie nicht totmachen.»
Ich hatte Angst. Wahnsinnige Angst! Grausame Angst! Sie war wie ein Stein in der Lunge. Heinz Steinschneider sagte merklich reserviert: «Das freut mich zu hören.» Und ich wusste nicht einmal, dass ich ihm gerade von Vater erzählt hatte.
Gretchen stand an der Küchentür und betrachtete mich mit ausdrucksloser Miene. In ihren Augen flackerte nichts mehr, weder Unbehagen noch Furcht. Ihr Blick war nur noch wie das Netz unter einem Trapez. «Nun lass dich endlich fallen. Du weißt doch, dass du dich an der Stange da oben nicht mehr lange halten kannst. Du hast zwanzig Jahre lang versucht, es dir leicht zu machen. Hier ein bisschen gemogelt, da ein bisschen gepfuscht, dort ein bisschen geschwindelt. Und du dachtest, so könnte es funktionieren. Aber niemand kann sich durchs ganze Leben lügen. Irgendwann holt die Wahrheit jeden ein.»
Meine Sätze kamen automatisch, so wie Vater sie mir vorgesprochen hatte. Ich wiederholte fast wörtlich die Geschichte vom hoffnungsvollen Polizisten, der zu unkonventionell für seinen Beruf war.
Heinz Steinschneider erinnerte sich nach ein paar Sekunden. «Ach, jetzt
Weitere Kostenlose Bücher