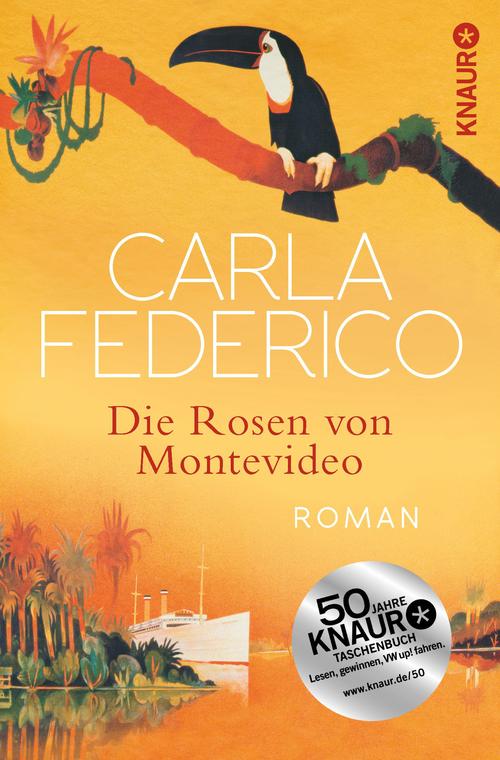![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
verstohlen fortwischte, Valentín jedoch nicht entgangen waren. Er musterte sie sichtlich bestürzt, doch anstatt sie zu trösten, versuchte er, sie abzulenken, indem er von weiteren Fischen erzählte – den Piranhas, die einen Dominikanermönch, der hier im Fluss badete, einst so schwer verletzt hatten, dass er das Gelübde der Keuschheit – selbst wenn er es gewollt hätte – fortan nicht mehr hätte brechen können.
Sie wusste nicht, ob er nur einen Scherz mit ihr trieb – seine Miene war auf jeden Fall todernst, und wie so oft wurde sie nicht schlau aus ihm. Sie beobachtete ihn häufig, und meist war sein Gesicht verschlossen – nur wenn er sang, standen Schmerz und Sehnsucht in seinen Zügen.
Fast jeden Abend griff er nun zu seiner hölzernen Harfe, sobald sie angelegt und am Ufer Feuer gemacht hatten. Und fast jedes Mal setzte sich Valeria in seine Nähe, lauschte gebannt und fragte hinterher, wovon seine Lieder handelten, trug er die meisten doch im unverständlichen Guaraní vor. Manchmal antwortete er nichts – manchmal erzählte er ausufernd von seiner Heimat, die er besang.
»Paraguay …«, sagte er, »allein der Name klingt wie Musik. Er bedeutet so viel wie ›Federfluss‹ oder ›Farbenpracht‹ und kündet davon, wie reich das Land an bunten Vögeln und Blumen ist.«
»Du klingst, als würdest du vom Paradies sprechen.«
»Es ist das Paradies … war es zumindest vor dem Krieg. Als meine Eltern und meine Schwestern noch lebten …«
Er schien gar nicht bemerkt zu haben, dass er die Worte laut aussprach – aber sie konnte nicht umhin, die Möglichkeit zu nutzen, mehr über ihn zu erfahren.
»Sie sind tot, nicht wahr? Deine Eltern … deine Schwestern … an sie habe ich dich erinnert, als ich blutüberströmt unter Jorge lag. Wie … wie sind sie gestorben?«
Er sah auf. Kurz schien er es zu bereuen, dass er seine Familie erwähnt hatte, aber ihm entgingen wohl nicht das ehrliche Mitgefühl in ihrem Blick und das aufrichtige Interesse an seinem Schicksal.
»Meine Familie besaß eine große Plantage nicht weit von der brasilianischen Grenze entfernt«, begann er. »Getreide wurde angebaut, auch Maniok. Viele Schwarze arbeiteten bei uns – nicht als Sklaven, sondern gegen einen gerechten Lohn. Als das brasilianische Heer im ersten Kriegsjahr die Grenze überschritt, haben sie die Schwarzen gegen uns aufgehetzt. Tshepo stand treu zu uns, aber alle anderen …« Er machte eine Pause und schluckte. »Eines Nachts sind sie ins Haus eingedrungen und haben die ganze Familie massakriert. Nur Pablo und ich konnten fliehen.«
Seine Worte klangen nüchtern, doch in seinem Blick standen all die durchlittenen Ängste, die Ohnmacht und die Trauer. Valeria glaubte, es mit eigenen Ohren zu hören: die Schreie der Frauen, die verzweifelten Versuche der Männer, sich zu wehren, Schüsse, Kampfgeschrei, brechendes Holz, das Knistern von Flammen.
Valerias Blick wanderte unmerklich zu Tshepo.
»Er hat versucht, unsere Schwestern zu schützen, denn er wusste, dass die Brasilianer nicht im Geringsten am Wohl von seinesgleichen interessiert waren – im Gegenteil. Als das Massaker vorbei war, haben die brasilianischen Soldaten jeden einzelnen Schwarzen erschossen. Nur er konnte mit uns flüchten. Später kämpften wir im Krieg Seite an Seite, lernten dort Pinon kennen und auch die anderen.«
Abermals ließ er vieles unausgesprochen, was Valeria nur aus seiner Miene lesen konnte – so auch, dass er diese Gemeinschaft nun als neue Familie ansah, aber dass ihm diese dennoch nicht wiederbringen konnte, was er verloren hatte: das gemächliche Leben auf der Plantage, die Zuversicht, dass das Leben es gut mit einem meinte, wenn man fleißig arbeitete, die Liebe seiner Mutter.
Das nächste Lied, das er sang – diesmal auf Spanisch –, handelte von ihr. Es hatte mehrere Strophen, war offenbar von ihm selbst gedichtet worden und eine Hymne auf jene freundliche Frau. Ihr Gesicht war kaum faltig, ihre Haare waren trotz ihres Alters schwarz und glänzend, die Hände kräftig. Sie konnten zupacken, aber auch liebevoll streicheln und vor allem die leckersten Speisen zaubern. Clarabella war eine großartige Köchin, ihre Chipas waren heißbegehrt: Für dieses Gebäck wurde Maniok mit geschmolzenem Käse, Fett, Salz und Anis verknetet, und daraus wurden liebevoll Laibe geflochten. Sie bereitete aber auch Sopa Paraguaya, eine Art Maisbrot, zu, Manioksuppe, dick wie Pudding, oder Dulce, in Zuckersirup
Weitere Kostenlose Bücher