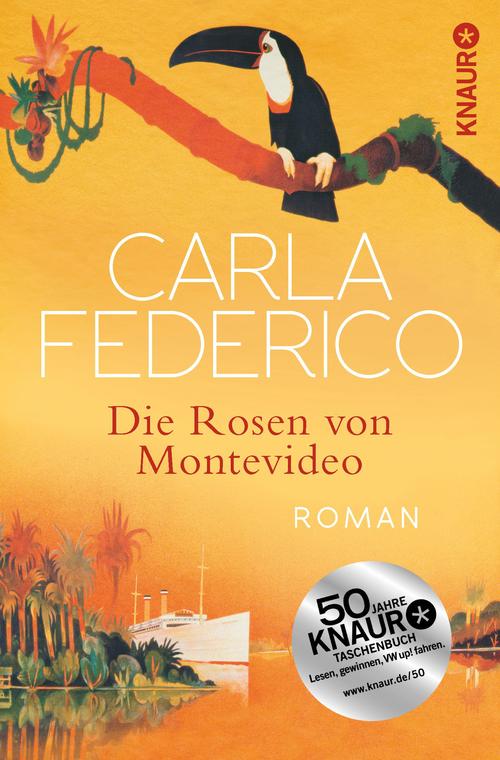![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
einem Soldaten gesehen, doch der marschierte nicht mit einer Truppe, sondern krümmte sich mit angstvollem Gesicht hinter einem Gebüsch. Als er sie erblickte, erschrak er nicht minder wie sie selbst.
Valentín deutete auf seine Uniform. »Du bist Paraguayer wie ich … und desertiert, nicht wahr?«
Der Mann nickte, sagte jedoch kein Wort – das Grauen schien ihm die Sprache geraubt zu haben. Valeria hatte Mitleid mit ihm und hätte ihm gerne angeboten, sie zu begleiten, aber Valentín lehnte es rundweg ab.
»Sieh doch, der Mann ist völlig zerstört. Er ist nicht stark genug, sich im Feindesland unauffällig durchzubringen. Gehen wir mit ihm, reißt er uns mit ins Verderben.«
So selbstsüchtig und grausam seine Worte auch klingen mochten – Valeria wusste, dass er recht hatte, und gab nach.
Immer noch ernährten sie sich von erlegten Tieren oder Fischen, doch ihre Kleider wurden immer dreckiger und zerrissener. Hätte jemand behauptet, sie wären nicht seit Monaten, sondern vielmehr seit Jahren unterwegs gewesen – sie hätte es geglaubt. In den kalten Nächten wärmten sie sich immer noch, aber sie liebten sich kaum mehr, weil Erschöpfung und Ekel vor dem eigenen stinkenden Körper jede Lust erstickten.
Irgendwann wurden die Häuser, die den Fluss säumten, zahlreicher, das Rauschen in der Ferne wurde lauter. Nicht mehr lange, dann würden sie das Meer erreichen – und mit ihm die Hauptstadt. Obwohl Valeria nicht in Montevideo aufgewachsen war, trieb ihr der Anblick der schaumgekrönten blauen Fluten, die eines Tages sichtbar wurden, Tränen in die Augen. Unwillkürlich erinnerte sie sich an den Tag ihrer Ankunft, wie leicht das Leben damals noch gewesen war und wie verheißungsvoll die Zukunft.
Valentín musterte sie bestürzt, und ihr gelang es nicht, den Aufruhr der Gefühle vor ihm zu verbergen. »Vielleicht wäre es besser, wenn sich unsere Wege hier trennen!«, rief er entschlossen. »Ohne mich bist du besser dran.«
Valeria schluckte die Tränen hinunter und schüttelte energisch den Kopf. »Ich liebe dich! Ich will mit dir zusammen sein.«
»Wenn man merkt, wer ich bin, dann wirst du …«
»Für meinen Onkel zählt es gewiss nicht«, unterbrach sie ihn scharf. »Er wird uns helfen.«
Sie nahm Valentíns Hand und zog ihn weiter. Seine Miene wirkte skeptisch, doch er sprach seine Zweifel nicht aus, und ihre Zuversicht wuchs mit jedem Schritt.
Ja, auf Onkel Carl-Theodor war immer Verlass gewesen. Bestimmt würde er sie nicht im Stich lassen. Nur noch ein, zwei Tage, und sie würden Montevideo erreichen. Und dann würde alles gut werden.
23. Kapitel
C arl-Theodor hatte nie zu den Männern gehört, die mit Alkohol das aufgewühlte Gemüt beschwichtigten und beim geselligen Zusammensein mit anderen Trinkfreudigen Entspannung fanden, doch seit Wochen verbrachte er die Abende in einem Wirtshaus. Es wurde von einer deutschen Einwanderin geführt, was bedeutete, dass die Tische sauberer waren als die der anderen Gaststätten und das Bier wie in der Heimat schmeckte. Er trank gerade so viel, dass er noch Herr seiner Sinne blieb, hinterher jedoch so müde war, dass er schnell und traumlos einschlief.
Heute blieb er ausnahmsweise weit über Mitternacht hinaus in der Gaststube hocken, denn größer noch als die Erschöpfung war der Widerwille, ins Haus der de la Vegas’ heimzukehren. Insgeheim schämte er sich dessen. Schließlich mied er nicht nur Julio und Leonora, sondern auch Claire, die eigene Tochter. Vor einigen Wochen war sie von der vergeblichen Suche nach Valeria heimgekehrt – zutiefst traurig, in Sorge und verstört. Doch so erleichtert er auch gewesen war, sie wieder sicher an seiner Seite zu wissen, fühlte er sich in ihrer Gegenwart unendlich hilflos: Unmöglich konnte er ihr Hoffnung geben, zumal Claire ein vernünftiges Mädchen war, in dem längst selbst die Einsicht gereift sein musste, dass es Valeria womöglich niemals wiedersehen würde, vor allem nicht jetzt, da der Krieg mit ganzer Härte neu ausgebrochen war. Anstatt aber mit ihm zu trauern, zog sich Claire von aller Welt zurück, und Carl-Theodor gelang es nicht, die Kluft zu überbrücken, sondern wurde von einer eigentümlichen Lähmung ergriffen. Er wusste, am besten wäre er sofort mit Claire abgereist, doch nicht nur sie weigerte sich beharrlich, Montevideo zu verlassen – auch ihm fiel es schwer, Entschlüsse zu treffen und umzusetzen.
Diese Lethargie war ihm nicht fremd. Früher hatte sie ihn meist an
Weitere Kostenlose Bücher