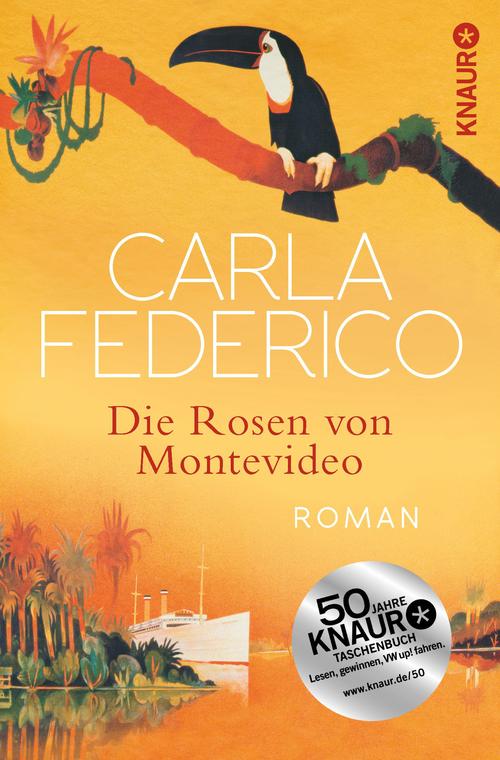![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
nicht, ich will endlich sterben.«
Doch er starb nicht – und musste auch keine neuen Schmerzen ertragen. Die Stimme richtete sich an ihn. »Mein Name ist Luis Silveira.«
Er wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Eben hatte er noch seinen eigenen Namen vergessen. Und auch dass er ihn wieder wusste, machte keinen Unterschied. Er konnte ihn ja doch nicht aussprechen. Als er den Mund öffnete, kam erst nur ein gequältes Stöhnen hervor, dann spuckte er einen Zahn aus. Er war sich nicht sicher, wo dieser nun fehlte, denn als er mit der Zunge nach dem Loch tasten wollte, war diese gänzlich taub. Er musste sie blutig gebissen haben.
»Claire hat mich gebeten, mich für Sie einzusetzen«, fuhr der Fremde fort. »Claire ist Valerias Cousine …«
Valeria …
Kurz vermeinte er, dass ihre Hände in jene Hölle drangen, ihn liebkosten, trösteten und die Hoffnung schenkten, dass alles gut werden könnte. Doch dann bemerkte er, dass es nicht ihre Hände, sondern die von diesem Luis Silveira waren, die seinen Körper abtasteten.
»Ich würde gerne einen Arzt schicken lassen, aber so weit reichen meine Befugnisse nicht. Das Einzige, was ich erreichen konnte, war, dass Sie nicht länger in den Zuständigkeitsbereich des Heeres, sondern der Polizei fallen …« Die Hände tasteten seinen Bauch ab. »Zumindest scheint nichts gebrochen zu sein.«
»Valeria … Was ist mit Valeria?« Valentín keuchte.
Die Stimme klang mit einem Mal kalt. »Sie sollten sich vor allem um sich selbst sorgen – nicht um sie. Sie ist bei ihrer Familie. Sie hingegen sind nichts weiter als ein Entführer und Dieb. Unter normalen Umständen würde man Ihnen sofort den Prozess machen und Sie aufhängen. Aber jetzt im Krieg kann ich dafür sorgen, dass man Sie vergisst und im Gefängnis verrotten lässt.«
Valentín erschien das mehr Strafe als Gnade zu sein. Er wollte lieber schnell sterben als quälend langsam.
Doch Luis Silveira fuhr fort: »Ich werde Sie ins staatliche Gefängnis verlegen lassen und versuchen, Sie dort vor neuer Gewalt zu bewahren. Ich fürchte nur, dass auch dort genug Männer sind, die nur darauf warten, einen Feind in die Hände zu kriegen.«
»Valeria …«, stammelte er wieder.
»Vergessen Sie sie. Sie kann Ihnen nicht helfen.«
Luis erhob sich.
»Richten Sie ihr aus …«
»Nein!«, zischte der andere unerwartet streng. »Ich helfe Ihnen um Claires willen und weil mir Gewalt gegen einen wehrlosen Mann zuwider ist. Aber ich stehe nicht auf Ihrer Seite, bin schon gar nicht Ihr Freund.«
Valentín sah nicht, wie er ging, sondern hörte nur die Schritte, die sich entfernten. Ehe die Tür wieder ins Schloss fiel, übermannte ihn die Ohnmacht erneut.
Valeria ging unruhig auf und ab. Manchmal wurde die Hoffnungslosigkeit so groß, dass sie sich aufs Bett warf, ihre Augen schloss in der Hoffnung, der Schlaf würde sie von sämtlichen Gedanken erlösen. Doch während ihr ausgezehrter Körper nach der Rückkehr tatsächlich ihr meist den Gefallen getan hatte, den wachen Geist zu besiegen, lag sie nun, da sie wieder zu Kräften gekommen war, immer öfter wach. Selbst wenn sie die Augen geschlossen hielt und sich dem Trug hingab, dass – solange sie nichts von der Welt sah – diese nicht ganz so grausam sei, konnte sie doch nicht leugnen, dass es zumindest Tante Leonora und Onkel Julio waren – nicht nur grausam nämlich, sondern regelrecht gnadenlos.
Sie hatten sich nicht damit begnügt, Valentín verhaften zu lassen – obendrein hatten sie sie auch in ihrem Zimmer eingesperrt, bis sie wieder Vernunft annähme. Je länger sie allerdings dort auf die Wände starrte, desto unwiderruflicher schien jeder Funken Verstand zu schwinden.
Möglichst reglos im Bett zu liegen, half da wenig; wie ein gefangenes Tier den Käfig abzuschreiten, leider auch nicht.
Sobald sich die Tür öffnete, stürzte sie hin, doch meistens war es nur Claire, die ihr Gesellschaft leistete und ihr etwas zu essen brachte. Heute war es frischer Maiskuchen.
»Hier, du musst dich ein wenig stärken …«
Valeria schlug ihr das Tablett aus der Hand. Der Teller zerbrach, der Zucker, der den Maiskuchen bedeckte, füllte die Ritzen des Holzbodens.
»Ich will keinen Maiskuchen!«, schrie sie. »Ich will hier raus!«
Claire ließ bedauernd ihre Schultern hängen. »Du weißt, dass ich nichts tun kann, so gern ich es auch möchte. Ich bin doch selbst nur ein Gast von den de la Vegas’. Das Einzige, was in meiner Macht lag, war, mich
Weitere Kostenlose Bücher