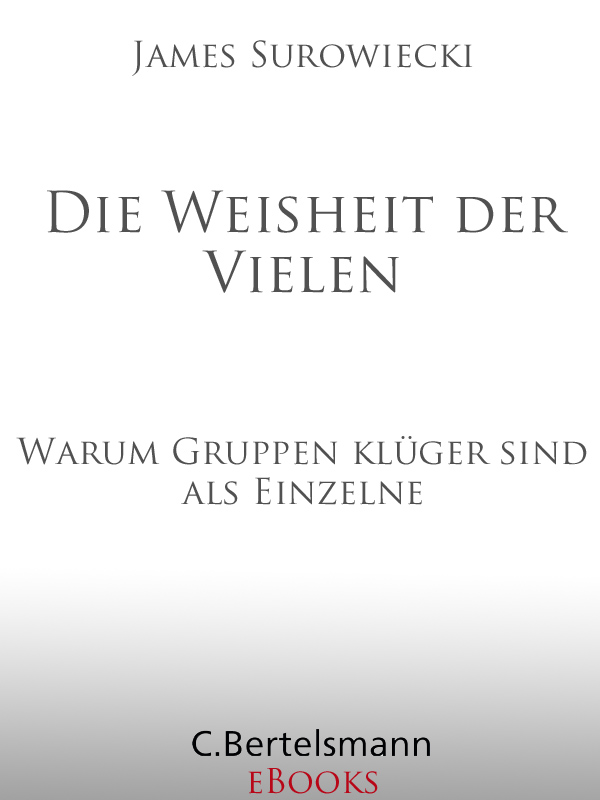![Die Weisheit der Vielen - Surowiecki, J: Weisheit der Vielen - The Wisdom of Crowds]()
Die Weisheit der Vielen - Surowiecki, J: Weisheit der Vielen - The Wisdom of Crowds
Mittelalter hat man den Mitgliedern der eigenen ethnischen oder regionalen Gruppe vertraut. Wie der Historiker Avner Greif nachwies, spannten die als Maghrebiner bekannten Händler aus Marokko im 11. Jahrhundert mithilfe eines Systems kollektiver Sanktionen ein Handelsnetz über den ganzen Mittelmeerraum. Wer ihre Geschäftsregeln verletzte, wurde bestraft. Der Handel zwischen verschiedenen Gruppen wurde gemäß den Richtlinien abgewickelt, die innerhalb der eigenen Gruppe Gültigkeit besaßen. Wenn ein Händler aus Genua jemanden in Frankreich übers Ohr haute, mussten alle Genueser Handelshäuser dafür den Preis zahlen. Das mag nicht gerade fair gewesen sein, schuf aber die Bedingungen, unter denen Handel zwischen Territorialstaaten gedeihen konnte, weil es die Handelskommunen zur Pflege fairer Geschäfte zwang sie dazu, intern Disziplin zu üben. Umgekehrt schützten Kaufmannsgilden – allen voran die deutsche Hanse – ihre Mitglieder gegen unfaire Behandlung, indem sie Stadtstaaten, die sich am Eigentum ihrer Mitglieder vergriffen, kollektiv mit einem Handelsembargo belegten.
Wie sich am Beispiel der Quäker zeigt, blieb die Vertrauensbasis innerhalb von Gruppen noch über Jahrhunderte relevant. Sie ist es übrigens – siehe den Erfolg chinesischer Geschäftsleute in den Ländern Südostasiens – auch heute noch. Zumindest in England entwickelte sich dann jedoch ein Vertragsrecht, das die individuelle Verantwortung hervorhob – und bedeutsamer noch: In der dortigen Geschäftswelt bildete sich ein generelles Verantwortungsbewusstsein heraus. »Als Basis und für den Erhalt der privaten Kreditwürdigkeit eines Menschen ist es absolut unerlässlich«, so kommentierte im Jahre 1717 ein Beobachter, »dass die Welt eine sichere Vorstellung von der Ehrlichkeit und Integrität wie den Fähigkeiten dieser Person hat.« Etwa zur gleichen Zeit schrieb Daniel Defoe: »Ein redlicher Händler ist wahrlich ein Juwel und wird als solches geachtet, wo immer eines gefunden wird.«
Der Tenor des Defoe’schen Diktums ist freilich auch ein Indiz, dass redliche Kaufleute damals eher dünn gesät waren. Und die Quäker erlangten für ihre Zuverlässigkeit eben darum Berühmtheit, weil sie eine Ausnahme bildeten. Fest steht aber doch, dass man sich in jener Epoche der Vorzüge ehrlichen Verhaltens und des Zusammenhangs zwischen Vertrauen und blühendem Handel bewusst wurde. In seinem Werk The Wealth of Nations [»Der Wohlstand der Nationen«] merkte Adam Smith an: »Wenn eine Nation vornehmlich aus Kaufleuten besteht, kommt durch sie stets Rechtschaffenheit und promptes Vorgehen in Mode.« Montesquieu äußerte sich lobend darüber, wie der Handel Menschen »verfeinert und mildert«. Erst im 19. Jahrhundert – zu einer Zeit, und das war wiederum kein Zufall, als der Kapitalismus in seiner uns heute bekannten Form zur Blüte kam – wurde diese Form des Vertrauens dann sozusagen institutionalisiert. Wie der Historiker Richard Tilly in einer Untersuchung über die Geschäftspraktiken in Deutschland und Großbritannien nachwies, setzte sich bei Kaufleuten bald nach 1800 die Einsicht durch, dass Redlichkeit sich sogar gewinnbringend auswirken konnte. Für Amerika zeigte es John Mueller in seinem wunderbaren Buch Capitalism, Democracy and Ralph’s Pretty Good Grocery : Es war ausgerechnet P. T. Barnum – uns Heutigen eher bekannt als schikanöser Ausbeuter von naiven Trotteln -, der moderne Geschäftspraktiken wie die vom Dienst am Kunden einführte. Zur gleichen Zeit setzte John Wanamaker als neue Norm des Einzelhandels den festen Ladenpreis durch. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es in Amerika zur Gründung unabhängiger Organisationen wie des Underwriters Laboratory und des Better Business Bureau, allesamt mit dem Ziel, für den alltäglichen Geschäftsverkehr ein Klima des Vertrauens zu erzeugen. Unterdessen baute an der Wall Street J. P. Morgan mit dem Ethos des Vertrauens ein gewinnträchtiges Bankgeschäft auf. Nach Aderlässen bei Kapitalanlagen in dubiose und unsolide Eisenbahngesellschaften im späten 19. Jahrhundert waren Kapitalinhaber (insbesondere ausländische) äußerst vorsichtig geworden, weiterhin in den Vereinigten Staaten zu investieren. Ein J.-P.-Morgan-Banker im Aufsichtsrat aber wurde dann zu einer Art Garantie für die Bonität und Zuverlässigkeit eines Unternehmens.
Kernelement dieses Wandels war die Orientierung hin zu einer langfristigen Kapitalbildung anstelle des bisherigen Interesses an
Weitere Kostenlose Bücher