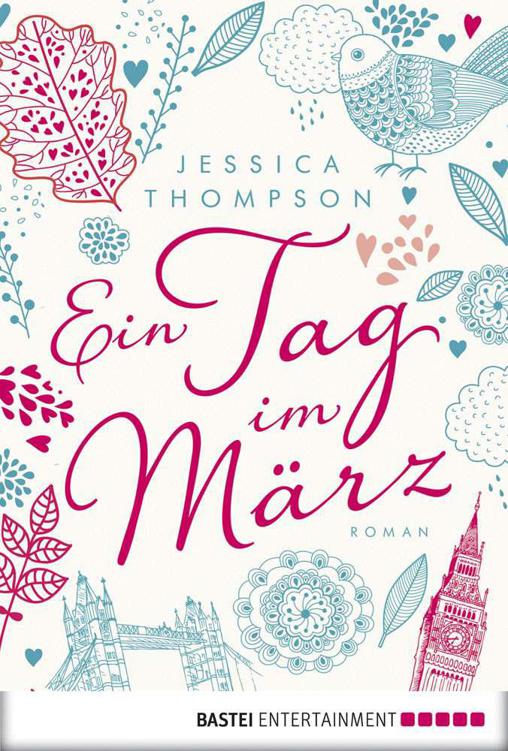![Ein Tag im Maerz]()
Ein Tag im Maerz
herumliegen, bis sie schimmelte. Und sie konnte sich dort vor nackter Frustration nicht das Haar büschelweise ausreißen, weil sie dort in der Öffentlichkeit war.
Das Café bestand aus einem hellen, luftigen Raum, erfüllt vom Geruch nach frischem Kaffee und weichen, frischen Croissants. Um sie herum wurden viele oberflächliche Gespräche geführt,die sie ablenkten. Was die Menschen zueinander sagten, war manchmal so komisch, dass sie lachen musste, und das hätte sie in ihrem inneren Aufruhr nie für möglich gehalten.
Sie saß am Fenster des Cafés und trug eine riesige dunkle Sonnenbrille, ihr neuester Schild, hinter dem sie ihren Schmerz verbarg. Die Sonnenbrille erlaubte ihr, die Welt vorüberziehen zu sehen und hin und wieder unbemerkt eine Träne zu vergießen.
Bryony kümmerte es nicht, ob man sie für verschroben hielt, weil sie so viel Zeit in dem Café verbrachte. Sie interessierte nicht, wie viel Geld sie für überteuerte Getränke zum Fenster hinauswarf. Und die Kalorien der Kuchen und Teilchen waren ihr ebenfalls nicht wichtig, denn im Moment aß sie nichts anderes.
Zu Hause zu kochen kam überhaupt nicht infrage. Mit der Küche waren zu viele Erinnerungen verbunden: der Sonntagnachmittag vor zwei Monaten, als Max stundenlang an einem Kuchen gearbeitet hatte und ihn prompt fallen ließ, als er ihn aus dem Ofen holte, oder das eine Mal, als er versehentlich eine Gabel in den Mikrowellenherd packte, woraufhin Lichtblitze durch den Raum schossen. Die hatten sie sogar noch auf dem Sofa aufgeschreckt, wo sie es sich gemütlich gemacht hatte, um ein Buch zu lesen. Solange er keine Kamera bediente, hatte er zwei linke Hände gehabt.
Im Café brauchte Bryony nicht zu fürchten, dass eine dieser Erinnerungen sie überfiel und traurig machte. Mehrmals in der Woche ging sie dorthin, um die Stunden zu vertreiben, beobachtete die Autos, die einander die Straße hinunter jagten, und die alten Frauen, die sich auf ihre Rollatoren stützten und vielleicht genauso einsam waren wie sie.
Die Wochen nach Max’ Tod waren die schwärzeste Zeit ihres Lebens gewesen.
Begonnen hatten sie mit dem unerträglichen Schmerz seinerAbwesenheit, der rasch zu Wut auf den Mann zusammengeschmolzen war, der ihrem Lebensgefährten das Leben geraubt hatte.
Hand in Hand mit der Wut kam unerträgliche Angst. Bryony hatte entschieden, dass sie niemals erfahren wollte, wer Max ermordet hatte, und das war zu einer fixen Idee geworden. Es war schlimm genug, sich das Gesicht oder die Augen eines Menschen vorzustellen, der so etwas über sich brachte, aber sie wollte ihre Vorstellungen nicht auch noch bestätigt sehen. Sie wollte nicht für den Rest ihres Lebens das Gesicht der abscheulichen Kreatur, die Max ermordet hatte, vor sich haben, wenn sie im Bett lag, als wären seine Züge in die Innenseiten ihrer Lider tätowiert. Wenn sie sein Gesicht nicht kannte, sagte sie sich, blieb wenigstens offen, wie der Mörder aussah – nur ein wirres Durcheinander verwunderter Gedanken in ihrem Kopf, das sich nie zu irgendetwas Realem würde zusammenfügen können.
Ihre Freundinnen fanden ihre Entscheidung merkwürdig, doch Bryony hatte sich geschworen, ihren Wunsch durchzusetzen. Sie war so entschlossen, nicht einmal den Namen des Mannes zu erfahren, der wegen des Mordes an Max festgenommen worden war, dass sie Zeitungen und Nachrichtensendungen vollständig mied. Bryony hatte Freunden und Familie klargemacht: Sie wollte nur wissen, dass der Kerl ins Gefängnis gesteckt worden war, um dort zu verfaulen, für wie lange und ab wann er einsaß. Das war alles.
Wenn sie die Zeitungsstapel an den Kiosken sah, überfiel sie die greifbare Angst, sie könnte versehentlich etwas entdecken – ein Verbrecherfoto, einen Namen, egal was. Es war schwierig, in Geschäften den Blick von den Seiten der Lokalzeitung abgewendet zu halten oder plötzlich aus der Schlange vor dem Geldautomaten oder aus der Damentoilette im Café zu fliehen, wenn sie hörte, wie jemand das Thema anschnitt.
Bald war ihr Vermeidungsverhalten zu einer Phobie geworden, und Bryony fragte sich manchmal, ob es normal war, so zu reagieren, wie sie reagierte. Gewöhnlich, so schien es, saßen die Angehörigen eines Mordopfers jeden Tag in den abweisend möblierten Gerichtssälen, verfolgten jede Wendung der Verhandlung und schauten dem Mörder in die Augen, bis er in sein erbärmliches Schicksal abgeführt wurde.
Aber das brachte sie nicht über sich. Sie würde sich dazu nicht
Weitere Kostenlose Bücher