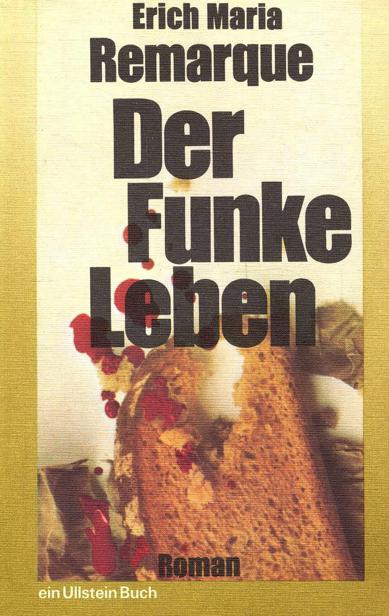![E.M. Remarque]()
E.M. Remarque
bißchen untergehendes Leben, das da summte und zirpte und pfiff und
kratzte, als seien die Baracken riesige Kisten mit sterbenden Insekten.
Um sieben Uhr begann die Lagerkapelle zu spielen. Sie stand außerhalb des
Kleinen Lagers, aber so nahe, daß sie gut zu hören war. Neubauers Anweisung war
prompt befolgt worden. Das erste Stück war wie immer der Lieblingswalzer des
Kommandanten: »Rosen aus dem Süden.«
»Laßt uns Hoffnung fressen, wenn wir nichts anderes haben«, sagte 509. »Laßt
uns all die Hoffnung fressen, die es gibt. Laßt uns das Geschützfeuer fressen!
Wir müssen durchkommen. Wir werden durchkommen!«
Die kleine Gruppe hockte nahe der Baracke zusammen. Es war eine kühle, dunstige
Nacht. Sie froren nicht zu sehr. Die Baracke hatte bereits achtundzwanzig Tote
in den ersten Stunden gehabt; die Veteranen hatten ihnen die Sachen ausgezogen,
die sie gebrauchen konnten, und sie selbst angezogen, um nicht zu frieren und
krank zu werden. Sie wollten nicht in die Baracke. In der Baracke keuchte,
stöhnte und schmatzte der Tod. Sie waren drei Tage ohne Brot geblieben und
heute auch noch ohne Suppe. Auf allen Betten kämpfte es, ergab sich und starb.
Sie wollten nicht hinein. Sie wollten nicht dazwischen schlafen. Das Sterben
war ansteckend, und es schien ihnen, als seien sie wehrlos dagegen im Schlaf.
So saßen sie draußen, die Sachen der Toten über sich gezogen, und starrten zum
Horizont, von dem die Freiheit kommen mußte.
»Es ist nur diese Nacht«, sagte 509. »Nur diese eine Nacht! Glaubt es mir.
Neubauer wird es erfahren und die Verordnung morgen aufheben. Sie sind bereits
uneinig. Es ist der Anfang vom Ende. Wir haben so lange ausgehalten. Nur noch
diese Nacht!«
Niemand antwortete. Sie saßen dicht zusammengedrängt wie eine Gruppe von Tieren
im Winter. Es war nicht nur Wärme, die sie sich gaben; es war vervielfachter
Lebensmut. Er war wichtiger als Wärme.
»Laßt uns über etwas reden«, sagte Berger. »Aber etwas, was nichts mit diesem
hier zu tun hat.« Er wandte sich zu Sulzbacher, der neben ihm hockte. »Was
willst du machen, wenn du hier herauskommst?«
»Ich?« Sulzbacher zögerte. »Besser, nicht darüber zu reden, bevor es soweit
ist. Es bringt Unglück.«
»Es bringt kein Unglück mehr«, erwiderte 509 heftig. »Wir haben nicht darüber
geredet durch all die Jahre, weil es uns zerfressen hätte. Jetzt aber müssen
wir darüber reden. In einer solchen Nacht! Wann sonst? Laßt uns fressen, was
wir an Hoffnung haben. Was willst du machen, wenn du herauskommst, Sulzbacher?«
»Ich weiß nicht, wo meine Frau ist. Sie war in Düsseldorf. Düsseldorf ist
zerstört.«
»Wenn sie in Düsseldorf ist, ist sie sicher. Düsseldorf ist von den Engländern
besetzt. Das Radio hat es längst zugegeben.«
»Oder sie ist tot«, sagte Sulzbacher.
»Damit muß man rechnen. Was wissen wir schon von denen, die draußen sind?«
»Und die draußen von uns«, sagte Bucher.
509 blickte ihn an. Er hatte ihm immer noch nicht gesagt, daß sein Vater tot
sei und wie er gestorben war. Es hatte Zeit, bis er frei war. Er würde es dann
besser ertragen.
Er war jung und hatte als einziger jemanden, der mit ihm hinausging. Er würde
es früh genug erfahren.
»Wie wird das nur sein, wenn wir herauskommen?« sagte Meyerhof. »Ich bin seit
sechs Jahren im Lager.«
»Ich seit zwölf«, sagte Berger.
»So lange? Warst du politisch?«
»Nein. Ich habe nur einen Nazi, der später Gruppenführer wurde, von 1928 bis
1932 ärztlich behandelt. Vielmehr nicht ich; er ist zu mir in die Sprechstunde
gekommen und dort behandelt worden durch einen Freund von mir, der Facharzt
war. Der Nazi kam zu mir, weil er im selben Hans wohnte wie ich. Es war für ihn
bequemer.«
»Und deshalb hat er dich einsperren lassen?«
»Ja. Er hatte
Weitere Kostenlose Bücher