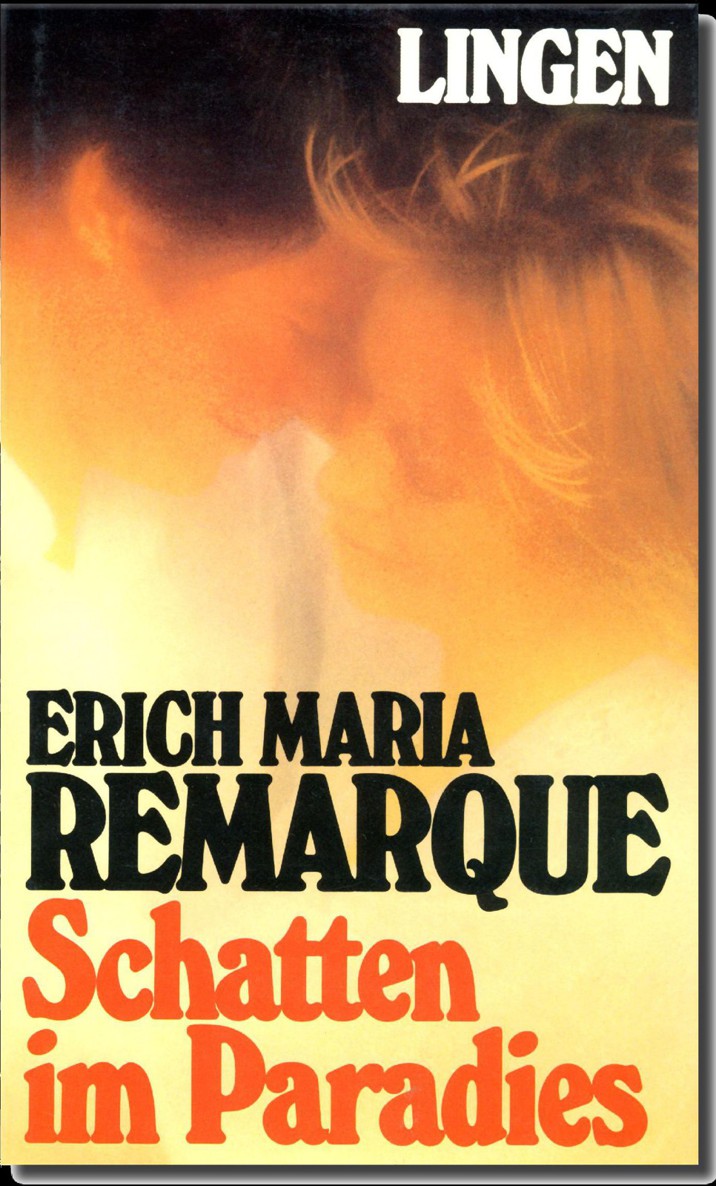![E.M. Remarque]()
E.M. Remarque
hatte. Den
Aschenbecher mit zwei rotgefärbten Mundstücken leerte ich durch das geräuschlos
geöffnete Fenster. Dann schlich ich zur Tür, öffnete sie und horchte nach
unten.
Das Hotel war still wie ein Grab. Von der
Halle her hörte ich Gemurmel. Dann kamen Schritte die Treppe herauf. Ich
erkannte sie sofort als Polizei. Darin kannte ich mich aus, ich hatte sie in
Deutschland, Belgien und Frankreich oft genug gehört. Ich schloß rasch die Tür.
»Sie kommen.«
Pedro ließ seine Zigarette fallen. »Sie
gehen nach oben«, sagte ich.
Pedro hob seine Zigarette auf. »Zu Melikows
Zimmer?«
»Das werden wir sehen. Warum glauben Sie,
daß die Polizei eine Haussuchung machen könnte?«
»Um etwas zu finden.«
»Ohne Haussuchungsbefehl?«
Pedro hob wieder die Schultern. »Befehl?
Bei armen Leuten?«
»Natürlich.« Das hätte ich mir denken
können. Warum sollte es in New York anders sein als irgendwo in der Welt? Und
ich sollte das wahrhaftig wissen. Meine Papiere waren gut, aber nicht sehr gut.
Pedros wahrscheinlich ähnlich. Auch bei der Puertoricanerin war ich nicht
sicher. Sicher war ich nur bei Natascha. Man würde sie entlassen. Bei uns
andern konnte das noch etwas dauern. Ich schnitt ein großes Stück von unserem
Schokoladekuchen ab und stopfte es in mich hinein. Die Verpflegung auf allen
Polizeistationen der Welt war schauerlich.
Ich blickte aus dem Fenster. Gegenüber
waren ein paar Fenster erleuchtet. »Wo ist das Zimmer Ihrer Freundin?« fragte
ich Pedro. »Kann man es von hier aus sehen?«
Er kam heran. Sein gelocktes Haar roch nach
einem süßlichen Öl. Im Nacken hatte er die Narbe eines Furunkels. Er blinzelte
nach oben. »Über uns. Eine Etage höher. Man kann es von hier aus nicht sehen.«
Wir mußten ziemlich lange warten. Ab und zu
horchten wir auf den Flur hinaus. Nichts rührte sich. Jeder, der im Hotel war,
wußte anscheinend, daß etwas los war. Keiner kam nach unten. Endlich hörte ich
die schweren energischen Schritte von oben kommen. Sie verloren sich nach
unten. Ich schloß die Tür. »Ich glaube, die Polizei geht. Keine Haussuchung.«
Pedro lebte auf. »Warum lassen sie die
Menschen nicht in Ruhe? Was tut schon ein bißchen Schnupfen, wenn es einen
glücklich macht? Im Krieg zerreißen sie Millionen mit Granaten. Hier verfolgen
sie das weiße Pulver, als wäre es Dynamit.«
Ich betrachtete ihn aufmerksam, seine
feuchten Augen mit dem bläulichen Weiß, und mir kam der Gedanke, daß er selbst schnupfen
könnte. »Kennen Sie Melikow schon lange?« fragte ich.
»Nicht so sehr lange. Einige Zeit.«
Ich schwieg; was ging es mich an? Ich
dachte darüber nach, ob man etwas für Melikow tun könnte. Da war nichts zu tun,
am wenigsten von Ausländern mit etwas zweifelhaften Papieren.
Die Tür ging auf. Es war Natascha. »Sie
sind weg«, sagte sie.
»Mit Melikow.«
Pedro war aufgestanden. Die Puertoricanerin
kam herein. »Komm, Pedro.«
»Vielen Dank«, sagte ich zu ihr. »Vielen
Dank für Ihre Freundlichkeit.«
Sie lächelte. »Arme Leute helfen sich gern
gegenseitig.«
»Nicht immer.«
Natascha küßte sie auf die Wange. »Vielen
Dank, Raquel, für die Adresse.«
»Was für eine Adresse?« fragte ich, als wir
allein waren.
»Für Strümpfe. Die längsten, die ich
gesehen habe. Sie sind schwer zu finden. Die meisten sind zu kurz. Raquel hat
mir ihre gezeigt. Fabelhaft.«
Ich mußte lachen. »Pedro war weniger
unterhaltend.«
»Natürlich. Er hatte Angst. Er schnupft.
Und er hat jetzt ein Problem: Er muß einen anderen Lieferanten suchen.«
»War Melikow einer?«
»Ein kleiner, glaube ich. Der Gangster, dem
dieses Hotel gehört, hat ihn dazu gezwungen. Er wäre sonst herausgeflogen. Eine
neue Stellung hätte er nie bekommen, er ist zu alt.«
»Kann man etwas für ihn
Weitere Kostenlose Bücher