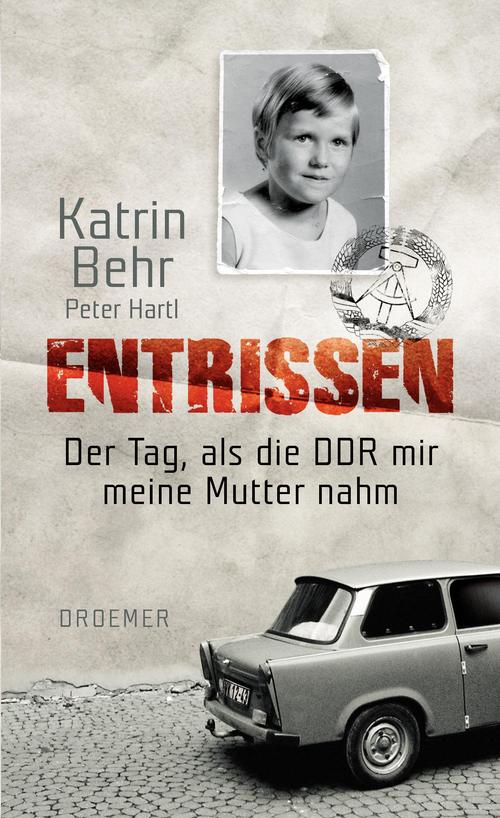![Entrissen]()
Entrissen
Hinterhalt. Erst jetzt, an diesem Novemberabend erreichte auch mich die Wende mit allen Konsequenzen.
Der Zwang zur Anpassung war aufgehoben. Ich fühlte mich rehabilitiert vom latenten Vorwurf des Staatsverrats. Zugleich erfasste ich ansatzweise, wie das Kartenhaus, welches meine Eltern, Lehrer und Betreuer im Sinne des Staates vor mir aufgetürmt hatten, nun ins Wanken geriet. Ich verspürte plötzlich das Bedürfnis, eine Entscheidung, die mich betraf, auch einmal vollkommen eigenständig zu fällen. Selbst wenn das nun keiner Zivilcourage mehr bedurfte, kramte ich meinen SED -Parteiausweis aus der Schreibtischschublade und gab ihn meiner Chefin zurück mit den Worten: »Das ist jetzt vorbei.« Sie sah mich verständnislos an, und ich war selbst ein wenig über meine Forschheit überrascht. Ich hatte diesen Schlussstrich auf meine Zugehörigkeit zur Partei bezogen.
Doch auch auf unseren Staat traf der Abgesang zu. Die DDR war drauf und dran, sich ziemlich unspektakulär aus der Weltgeschichte zu verabschieden. Für die deutschen Teilstaaten auf beiden Seiten des Stacheldrahts hatte dieser Wall eine bequeme Funktion erfüllt: Die Mauer schied die Welt, aus jeweils konträrem Blickwinkel, in Gut und Böse. Dieses Lagerdenken hatte nun keinen Bestand mehr, obwohl wir noch nichts davon merkten.
Unsere absehbare Eingliederung in die westliche Welt weckte Existenzängste in mir. Ende 1989 fanden nun selbst auf der Uferpromenade des Rügener Strandbades Binz die ersten Montagsdemonstrationen statt. Auf selbstgemalten Pappschildern forderten die Menschen Reisefreiheit. Ich betrachtete diese Kundgebungen mit Interesse, aber Abstand. Ich hatte andere Sorgen. Jahrelang geprägt durch die sozialistische Schulung, fürchtete ich mich vor dem bevorstehenden Kapitalismus, wie wir ihn als Schreckgespenst kannten. Mussten wir jetzt um unsere Arbeitsplätze bangen?
Für meinen Mann, mehr noch als für mich, muss in dieser Phase eine Welt zusammengebrochen sein. Die Armee hatte über Nacht keine Verwendung mehr für marxistisch-leninistisch geschliffene Politoffiziere. Sonderstellung, Kaderkarriere und Dienstwohnung gehörten in kürzester Zeit der Vergangenheit an. Ich vermag nicht zu sagen, ob Olaf die Zeit nach der Grenzöffnung auch als persönliche Niederlage empfunden hat. Merkwürdigerweise redete ich mit ihm über solche Fragen nie. In Berufsangelegenheiten blieb er verschlossen wie zuvor, und ich wich weiter heiklen Gesprächen aus, zumal unsere Existenz in dieser Zeit in jeder Hinsicht neu zusammengefügt werden musste.
Im Januar 1990 reichte Olaf seine Kündigung bei den Streitkräften ein und wurde im Rang eines Majors entlassen. Kurz darauf gelang ihm als gelerntem Gleisbaumechaniker der Wechsel zur Reichsbahn in seiner Heimatstadt Arnstadt. Er tauschte die grüngraue Armeeuniform gegen die dunkelblaue Dienstkleidung der Bahn, und zu unserer Beruhigung beförderte ihn sein früherer Rang in eine gleichwertige Lohngruppe. Unsere neue Wohnung in Arnstadt glich zu Beginn eher einer trostlosen Kaschemme. Auch wenn der Kontakt zu unseren Eltern sporadisch blieb, versagten sie uns ihre Unterstützung nicht. Während Vati auf meine Bitte mit Olaf unsere neue Bleibe handwerklich versiert herrichtete, kamen wir vorübergehend bei meinen Schwiegereltern unter. Für die Zeit unseres Aufenthalts dort fand ich im örtlichen Kreiskrankenhaus von Arnstadt eine Stelle.
Trotz hoffnungsfroher Zukunftsaussichten nahmen wir die Neuigkeit meiner erneuten Schwangerschaft im ersten Moment wie eine Hiobsbotschaft auf. In unsicheren Umbruchszeiten hatten wir den Kinderwunsch eigentlich zurückgestellt, aber der neue Erdenbürger war schneller.
Zu allem Überfluss brachte Olaf, als er mir in der Badewanne über meinen Kugelbauch strich, es fertig, zu sagen: »Wer weiß, ob der überhaupt von mir ist.«
Diese grundlose Unterstellung trieb mir die Tränen in die Augen. Ich richtete mich auf und schleuderte ihm resigniert entgegen: »Eben hast du auch den letzten Rest unserer Liebe kaputt gemacht!« Das entsprach in diesem Moment meinem Empfinden, denn ich fühlte jene innere Leere, die ich aus meiner Jugendzeit kannte.
Wieder ging mir die Kraft zur Gegenwehr aus, und ich verkroch mich in meiner Verzweiflung über das Scheitern unserer Liebe. Je mehr Ablehnung ich erfuhr, desto wichtiger wurde mir mein Mutterdasein. Ich wollte dieses Kind bekommen, eine Abtreibung kam für mich nicht in Frage. Bei allen Ungewissheiten und trotz der
Weitere Kostenlose Bücher