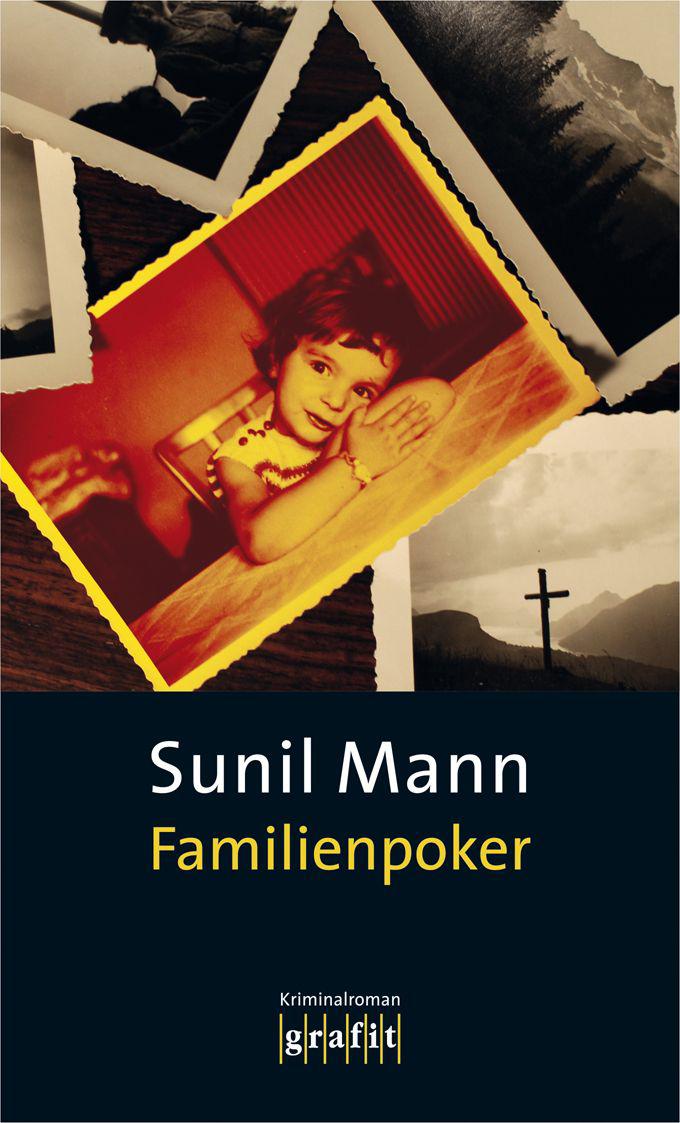![Familienpoker: Vijay Kumars vierter Fall (German Edition)]()
Familienpoker: Vijay Kumars vierter Fall (German Edition)
Glück.« Sie verzog ganz leicht den Mund, und ich sah etwas Süffisantes in ihren Augen aufblitzen. »Maria, unsere Oberschwester, sagt, sie erinnert sich gut an ihn. Wenn es euch nichts ausmacht, kurz zu warten …«
Zwei aus zweihunderteinundzwanzig Millionen. Maria, die Empfangsdame, deutete auf ein paar blaue Polsterstühle mit fleckigem Bezug, die der Wand nach aufgereiht waren und offenbar das Wartezimmer ersetzten.
»Maria, Sie sind ein Engel!«, raspelte ich Süßholz, bevor ich José folgte, der sich abschätzig schnaubend auf einen der Stühle fallen ließ. Auf dem äußersten Sitz starrte ein älterer Mann in einem ausgebeulten Jäckchen vor sich hin, sonst war niemand zu sehen.
Einen Moment saßen wir schweigend nebeneinander. Der Eingangsbereich sah mitgenommen aus. Kabel hingen von der Decke, der Linoleumboden war voller Löcher, die an Hagelschlag erinnerten, die Scheiben der winzigen Fenster rissig und halbblind. Tageslicht drang kaum noch herein. Hier wurde deutlich, was ich sonst nur aus den Nachrichten vernahm: Dem Staat fehlte es an allen Enden an Geld, im Gesundheitswesen wurde ohne Rücksicht auf Verluste gespart. Die Angestellten wurden angeblich lausig bezahlt und waren notorisch unterbesetzt. Bislang hatte ich außer Maria noch kein Personal entdeckt.
»Señor Gonzalez, zur Dialyse bitte«, schepperte plötzlich Marias Stimme über die Lautsprecheranlage. »Señor Gonzalez, zur Dialyse. Sie werden im nephrologischen Ambulatorium im zweiten Stock erwartet.«
Der Mann neben uns erhob sich ächzend und ging auf die Aufzüge zu. Als er das Ende der Halle beinahe erreicht hatte, kündigte ein leises Klingeln die Ankunft eines Lifts an.
Die ältere Frau, die heraustrat, nickte kühl in unsere Richtung und kam dann mit entschlossenen Schritten auf uns zu. Sie trug eine Schwesterntracht, die sich beim Näherkommen als weißer Habit entpuppte, über die Schultern hatte sie sich ein himmelblaues Cape gelegt. An beiden prangte eine Medaille der Heiligen Jungfrau, anstelle eines Gürtels trug sie einen Strick. Nicht zum ersten Mal am heutigen Tag stellte ich fest, dass katholische Insignien schlechte Laune zu verursachen schienen.
»Man hat mich informiert, dass Sie Doktor Sánchez suchen«, eröffnete die Oberschwester grußlos das Gespräch. »Darf ich erfahren, was der Grund dafür ist?«
José breitete erneut seine erfundene Familiengeschichte aus, doch Maria winkte ab, bevor er sie zu Ende erzählen konnte.
»Das ist natürlich eine tragische Situation, doch leider kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo sich Doktor Sánchez zurzeit aufhält«, erklärte sie. »Denn ich weiß es selber nicht. Wenn das alles gewesen ist …« Einen Moment lang blieb sie unschlüssig vor uns stehen, bevor sie sich zum Gehen wandte.
»Aber Sie haben ihn doch persönlich gekannt?«, hakte José nach, worauf die Nonne innehielt.
»Ja, wir haben jahrelang eng zusammengearbeitet.«
José warf mir einen warnenden Blick zu, doch ich hatte ohnehin nicht vorgehabt, mich einzumischen.
»Haben Sie vielleicht Fotos von ihm?«
»Dazu sollten Sie wohl besser mit Ihrer Familie …«
»Unmöglich, wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr, die Verhältnisse sind zerrüttet«, log José erneut. »Onkel Alberto ist die einzige Verbindung zu meiner Sippe, die mir geblieben ist. Ich wüsste so gern, wie er ausgesehen hat. Ob ich mich in ihm wiederfinde.«
Oberschwester Maria musterte uns kritisch und schien mit sich zu ringen.
»Bitte! Sie sind meine einzige Hoffnung!«, flehte José.
Mit einer angedeuteten Kinnbewegung forderte sie uns schließlich auf, ihr zu folgen. Als wir uns erhoben, zwinkerte mir José frohlockend zu.
»Sie kommen aus der Schweiz, sagen Sie?«, versicherte sich die Nonne, während wir auf den Aufzug warteten.
»Richtig«, antwortete José.
»Und Sie sind ausschließlich aus privaten Gründen hier?«
José sah sie fragend an.
»Ich will nur sichergehen. Manchmal schleichen sich Journalisten ein, verkommene Menschen ohne Anstand und Ehre, die Unwahrheiten verbreiten und versuchen, unsere Arbeit schlechtzumachen.«
José machte eine abwehrende Handbewegung. »Wie gesagt: Ich hoffte nur, hier meinen Onkel zu finden.«
»Ich verstehe.«
Schweigend fuhren wir in den fünften Stock.
Die Oberschwester war weit über sechzig und machte einen ausgezehrten Eindruck. Ihrer distanzierten Haltung konnte ich nicht entnehmen, was sie von uns hielt. Es erstaunte mich ohnehin, dass sie uns mit hochnahm,
Weitere Kostenlose Bücher