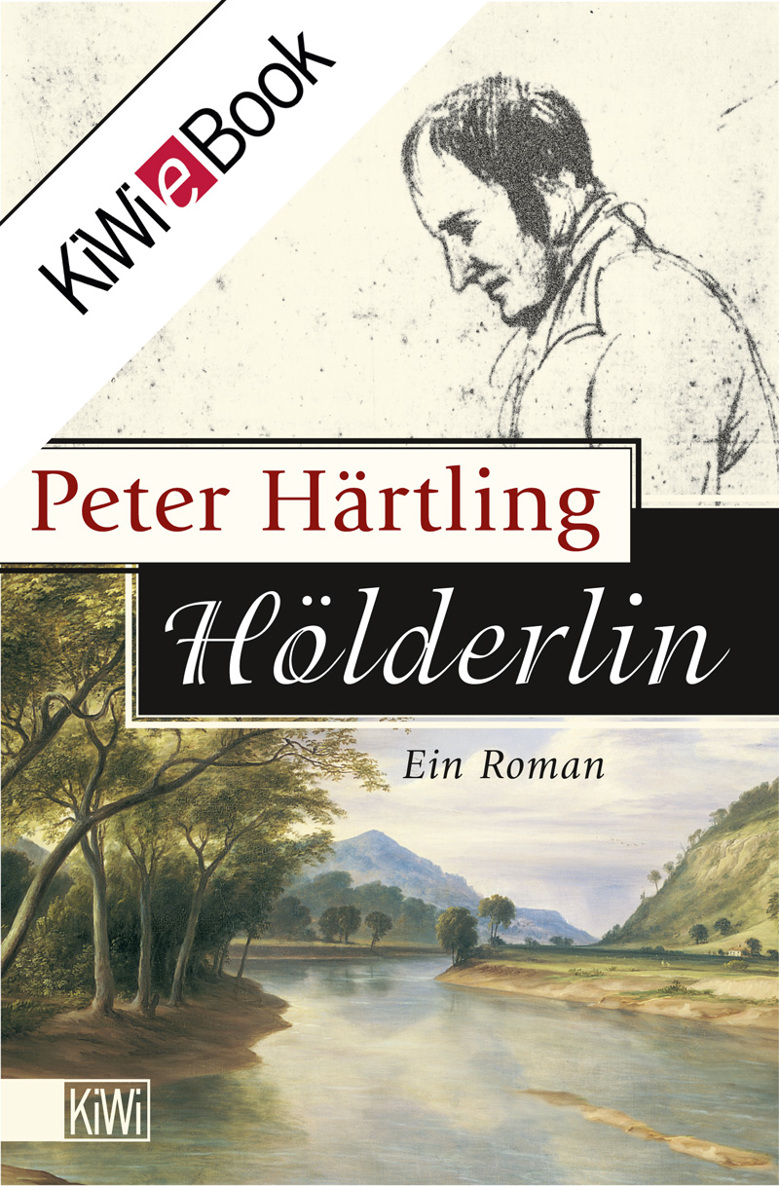![Härtling, Peter]()
Härtling, Peter
und achtet sehr darauf, daß sein Umgang ihm angemessen ist.
Soll ich dir meine neuen Abhandlungen schicken, Hölder?
Ja, jetzt hab ich Zeit, sie zu lesen.
Vor allem »Vom Ich als Prinzip der Philosophie« solltest du lesen. Es ist mir wichtig. Ich bin weit hinter Fichte zurück, mir fehlt die Klarheit.
Fichte ist nicht weiter als du, Schelling.
Du bist gut.
Mir ist’s ernst.
Sie müssen zwischen den Sträuchern am Fluß hintereinander hergehen. Schelling, gebückt, sich vor den stachligen Ästen hütend, geht voraus. Hölderlin genießt die Stunde: Einmal nicht an die Zukunft denken, auf irgendwelche Botschaften warten zu müssen, einen guten Freund bei sich und die Landschaft der Kindheit um sich zu haben, frisch vom Bad, träg von der Wärme. Bei Fichte hatte ich manchmal die Vorstellung, sagt Hölderlin, die Philosophie könne an ein Ende gelangen. Aber das kann nicht sein. So wie ein Gedanke dem anderen folgt, ihn korrigiert, ersetzt. Verstehst du? Philosophie ist für mich unendlicher Fortschritt, und die Poesie begleitet sie, oft unwissend.
Und die Geschichte?
Sie zehrt von beiden. Robespierre oder vielmehr noch Empedokles, von dem ich gelesen habe, die Tribunen,haben die Einheit mit dem Göttlichen ausgespielt und sind als Menschen an die Stelle der Gottheit getreten. Nur so haben sie dem Volk das Neue auch sichtbar, spürbar machen können. Dann folgt der ungeheure Bruch. Soll das Neue sich verwirklichen, müssen sie aus dem Göttlichen zurücktreten, da der Mensch, jeder einzelne, sich selbst im Gemeinsamen verstehen muß. Die Entzweiung der Welt muß wieder sichtbar werden. Darunter leidet der Mensch und wird ewig darunter leiden. Empedokles verzichtet auf den Triumph und versucht so zu sühnen und zu vereinen. Im »Hyperion« sag ich ähnliches.
Und du meinst, daß es nie eine Versöhnung zwischen Anspruch und Hoffnung geben kann?
Vielleicht, Schelling. So weit habe ich noch nicht zu denken gewagt. Daß ich die Spaltung verstanden hab, ist mir im Moment genug.
Zwischen Neckarhausen und Nürtingen will Schelling umkehren. Sonst komm ich in die Nacht.
Bleib doch bei mir. Hölderlin muß ihn nicht lang überreden. Johanna ist über den Besuch froh. Sie werde Karls Zimmer für ihn bereitmachen. Karl sei für einige Tage in Stuttgart. Er habe gute Aussichten auf eine bessere Position.
Aber Mamma, Herr Schelling kennt den Karl gar nicht. Doch, isch des net des Büble g’wese, mit dem du oft spaziere gange bisch?
Ja, der war’s. Der ist inzwischen Schreiber.
Schelling sagt, er müsse auf das Angebot verzichten, da seine Verwandten in der Brunnsteige es ihm verübelten, schliefe er nicht bei ihnen.
Aber e Stündle bleibsch no.
Sie saßen bis in die Nacht.
Endlich, im August, erhält Hölderlin von Ebel den Bescheid, daß der Bankier Gontard ihn einstellen wolle.
Gontard werde ihm schreiben. Er solle sich ausschließlich um den neunjährigen Sohn des Geschäftsmannes kümmern. Die Madame Gontard, das wolle er noch hinzufügen, sei eine wahrhaft verehrungswürdige Person.
Kann er überhaupt Erzieher sein? Ist er nicht viel zu wenig mit sich selbst im Reinen, um ein Kind überzeugen, leiten zu können? Aber hat er nicht Herz, mehr Liebe als viele andere, die er kennt? Und seine Ungeduld?
Köstlin redet ihm die Zweifel aus.
Du bist zart, Fritz, du gehst auf Kinder ein, du bist kein Berserker und du hast Geist. Und den braucht man als Pädagoge. Denk an deinen Rousseau.
Er hatte sich, als er noch auf dem Stift war, mit Köstlin und Kraz über Rousseau gestritten. Sie hatten über seine »schwelgerischen Ideen« gespottet. Die Vernunft komme nicht aus der Natur, denn Tiere hätten ebensowenig Vernunft wie Pflanzen – Vernunft sei einzig und allein das Resultat von Wissen. Da sich das »unvernünftige Kind« dem Wissen widersetze, seien Strenge, ja Unerbittlichkeit nötig.
Hatten sie nicht recht? Haben seine Erfahrungen mit Fritz sie nicht bestätigt? Nein. Diesem Jungen waren die Wurzeln der Vernunft mit groben Werkzeugen herausgehauen worden. Er hatte ihm gar nicht helfen können. Ebel hatte ihm jetzt von einem sanften, verständigen Kind geschrieben, von einer angenehmen Häuslichkeit. Hier könnte es ihm doch noch gelingen, den Rousseauschen Anspruch zu erfüllen. Und, wie bei Fritz von Kalb, entwirft er ein Programm für sich und seinen Schüler, allerdings weniger aufs Sittliche pochend, denn dieses Mal ist der Empfänger desBriefes nicht Schiller, das Vorbild, sondern Ebel, der
Weitere Kostenlose Bücher