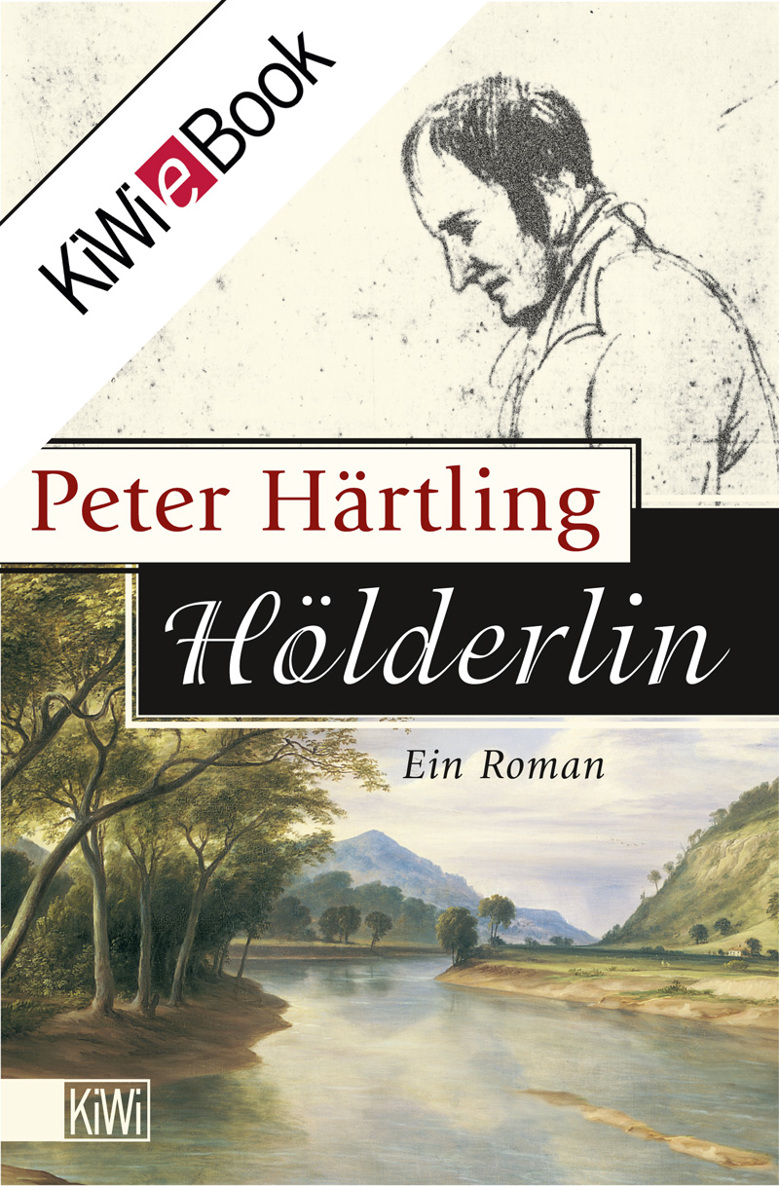![Härtling, Peter]()
Härtling, Peter
lacht.
Anfang September, endlich, hält er das Belegstück von Stäudlins »Musenalmanach« in der Hand. Wer hat es ihm gebracht? Neuffer, der zufällig in Stuttgart war? Ein Bote, dem er aus Freude einen Kreuzer mehr als nötig gab?
Erst bleibt er für sich, blättert, doch er muß nicht suchen, das Bändchen beginnt mit seiner »Hymne an die Muse«. Stäudlin, der Freund, hat ihn vor allen anderen, selbst vor Conz, bevorzugt. Er ist stolz. Ob die Welt sein Erscheinen wahrnehmen wird? Schubart rezensiert schon in dennächsten Tagen den Almanach in seiner »Chronik« und weist nachdrücklich auf »Hölderlins ernste Muse« hin. Das ist in diesem Moment viel, doch ihm zu wenig. Er wünscht sich, daß sie ihn tiefer verständen, daß sie ahnend und vorausschauend läsen.
Immerhin, er hat sich als Dichter ausgewiesen. Und kein Geringerer als Stäudlin fördert ihn.
Auf dem Gang vor der Stube unterhält sich eine Gruppe von Stipendiaten. Er hört Conzens Stimme heraus, reißt die Tür auf, ruft, das Bändchen vorzeigend: Des isch Stäudlins neuer Almanach! Er sagt nicht: Habt Ihr’s schon gesehen, gelesen? Meine Gedichte! Jede witzelnde Bemerkung über den Poeten würde ihn jetzt verletzen. Conz nickt nur: I komm glei. So wartet er, seine Freude teilen, mitteilen zu können. Conz beeilt sich nicht, schwätzt und schwätzt, und er zwingt sich, gelassener zu sein, denn für Conz ist es selbstverständlich, sich gedruckt zu sehen. Er setzt sich an den Tisch, auf dem die Bücher und Papiere der Studiengefährten herumliegen. Die Unordnung verdrießt ihn mit einemmal. Sonst hatte sie ihn nie gestört. Aber für diesen Augenblick möchte er’s aufgeräumt, wohnlich haben. Es wäre schön, zu Hause zu sein, bei der Mutter. Sie wäre stolz auf ihn, vielleicht auch ein wenig ängstlich. Denn trennt er sich nicht mit diesen Gedichten für alle Welt sichtbar von ihr, hatte nicht damit seine Schwärmerei, seine Kindheit ein Ende? Übertreib net, sagt er vor sich hin.
Doch dann übertrieb Conz, von dem er es, nachdem er zuvor auf dem Gang so zerstreut getan hatte, nicht erwartete. Conz stürmte herein, und jede seiner Bewegungen wirkte, weil er sich in seiner Schwere anstrengen mußte, ein bißchen lächerlich. Er riß ihn vom Stuhl hoch, umarmte ihn.
Des mueß g’feiert werde, Hölder!
Die Heftigkeit genierte ihn.
So wichtig isch’s au net.
A was. M’r wird von dir sprechen. Der Hölderlin! sei g’wiß, denk nur an Schnurrer oder an Lebret. Für die wirsch du plötzlich wer sein.
Ja, der Lebret, sagt er. Wie du auf solche Sachen kommst?
Du ändersch di net, Hölder. D’ Welt isch für di e schmerzliches Rätsel. Komm, m’r gucket nach deine Auguschtinerbrüder.
Und mit denen, mit Hegel, Schelling, Breyer und dem später hinzukommenden Neuffer wird nun »Hölderlins Auftreten als Dichter«, wie Schelling es bedeutungsvoll nennt, gefeiert, eines jener Feste, deren Hochstimmung sie gewissermaßen erzeugen können, bereit, sich Gefühlen hinzugeben, sich mitreißen zu lassen, auch, gerührt, in Tränen auszubrechen. Neuffer, ebenfalls mit einigen Gedichten in dem Bändchen vertreten, ein »guter Tugendsänger«, ermuntert ihn, alle vier Hymnen vorzulesen, selbst wenn jeder sie schon kennte, nun erst hätten sie ihre Prüfung bestanden.
Hölderlin stellt sich hinter seinen Stuhl, die linke Hand auf der Lehne, in der rechten das Buch: »Dann am süßen heißerrungenen Ziele, / Wenn der Ernte großer Tag beginnt, / Wenn verödet die Tyrannenstühle, / Die Tyrannenknechte Moder sind, / Wenn im Heldenbunde meiner Brüder / Deutsches Blut und deutsche Liebe glüht, / Dann, o Himmelstochter! sing ich wieder, / Singe sterbend dir das letzte Lied.«
Die Freunde applaudierten ihm, er habe Mut, mit dieser Hymne verbünde er sich Schiller, nur Breyer gab zu bedenken, ob es nicht gefährlich sei, gerade als Stipendiatdes Herzogs solche Verse zu publizieren. Das erzürnt Hegel, der sich gern kämpferisch gebärdet: Mußt du denn dauernd auf Zehenspitzen daherkommen, Vetter Breyer? Hölderlin hätte ihm anders antworten können: Ja, als ich es jetzt wieder las, schwarz auf weiß, ist mir durchaus Angst geworden. Ich geb’s zu. Aber weißt du, dieses Gedicht ist aus der Nähe zu Stäudlin entstanden, aus meiner Wertschätzung für ihn, und er freute sich, daß ich wenigstens hier seine Sprache finde.
Das Gedicht »Meine Genesung« ließ er aus, las er nicht. Jeder wußte, wen er mit seiner Lyda, die er in dem Gedicht anspricht,
Weitere Kostenlose Bücher