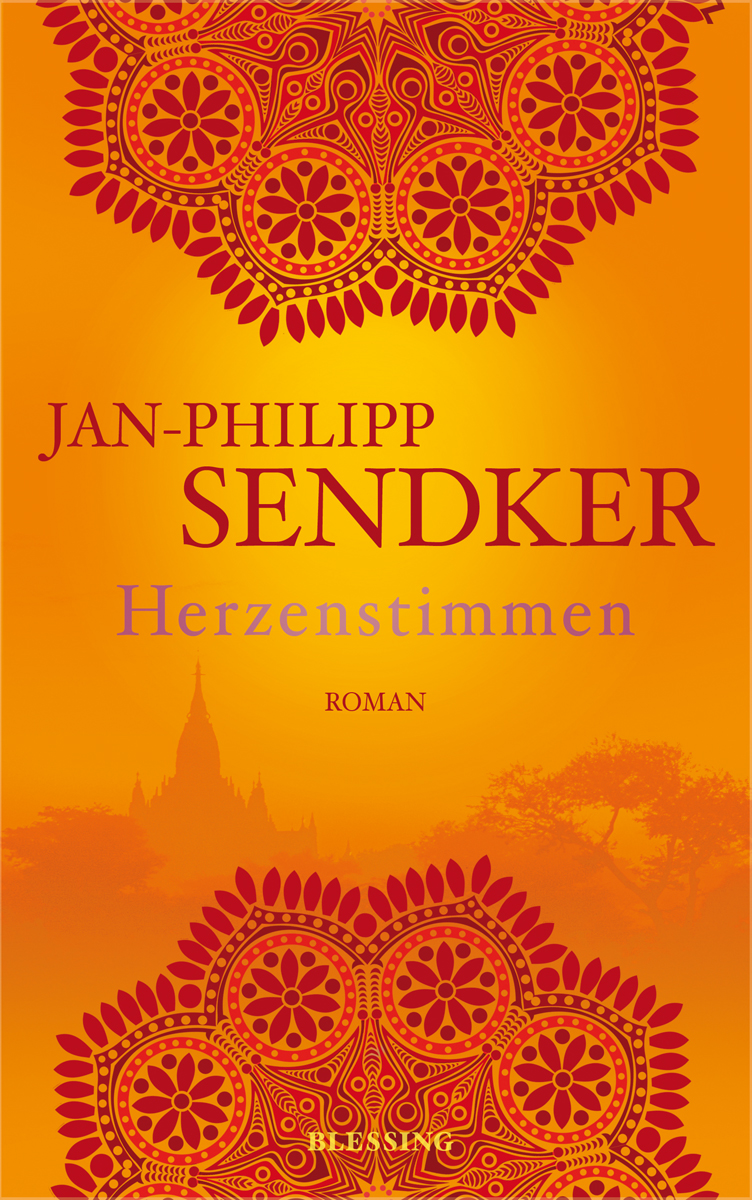![Herzenstimmen]()
Herzenstimmen
bereits vor Wochen dankend abgelehnt.
Ich hatte die Stadt noch nie so leer erlebt. Kaum Autos auf den Straßen, Geschäfte und Cafés waren geschlossen. Selbst der Obdachlose, der immer an der Ecke Second Avenue und 59th Street saß, war verschwunden. Ich rief ein halbes Dutzend Restaurants an, um mir Essen nach Hause zu bestellen, keines war geöffnet.
Am Abend roch es im ganzen Haus nach gebratenem Truthahn.Aus den Wohnungen auf meiner Etage drang das Lachen der Feiernden auf den Flur. Das helle Klirren der Gläser. Die Aromen von Backpflaumen, glasierten Karotten, Bohnen, Süß kartoffeln und Kürbiskuchen.
Der elendige Gestank der Einsamkeit.
Ich aß Reste aus dem Kühlschrank und trank, gegen den heftigen Protest der Stimme, fast eine ganze Flasche Rotwein. Sie behielt recht. Der Alkohol tat mir nicht gut. Ich fing an, mich selbst zu bemitleiden. Irgendwann kauerte ich weinend auf dem Sofa.
Am Sonntagabend kam Amy aus Massachusetts zurück. Wir hatten in den vergangenen Tagen mehrfach telefoniert. Sie war erleichtert, als ich die Medikamente absetzte, und bot immer wieder an, mit mir ein paar Tage aufs Land zu fahren. Sie machte sich jetzt ernsthaft Sorgen. Ob ich nicht doch mit ihr ins buddhistische Zentrum kommen wollte? Die Abgeschiedenheit würde mir guttun. Versprochen. Und wenn nicht, wären wir in drei Stunden wieder in Manhattan. Was hatte ich zu verlieren?
Mir war es mittlerweile egal, wohin wir fuhren. Ich war am Ende meiner Kraft. Ich wollte nicht mehr allein sein. Ich wollte raus aus der Stadt.
10
D as Taxi wendete. Es rollte langsam den Waldweg wieder hinunter, der Fahrer warf Amy und mir noch einen mitlei digen Blick zu, dann war er hinter einer Kurve verschwunden.
Eine unheimliche Ruhe umgab uns. Keine Vögel, keine Insekten mehr. Nicht einmal Wind rauschte in den Wipfeln.
Ich blickte mich um. Kaum Farben. Laublose Bäume, karge Böden, Felsbrocken, die aus der Erde ragten. Eine Welt in Graubraun. Menschenlos.
Für einen langen Augenblick fühlte ich mich wie ausgesetzt.
Amy schulterte ihren Rucksack, nickte mir zu und ging vor an. Wir liefen einen Pfad hinauf, durchquerten ein Waldstück, bis auf einem Hügel vor uns ein absonderliches Gebäude auftauchte. Der untere Teil sah aus wie ein rechteckiges, flaches Konferenzzentrum mit großer Fensterfront. Darauf hatte je mand ein Pagodendach gesetzt samt achteckiger Kuppel, Tür mchen, Goldverzierungen und buddhistischen Symbolen, die auf den Ecken thronten. Es war eine scheußliche Mischung. Unser Weg führte geradewegs dorthin.
Am Eingang empfing uns eine kleine Frau in einer hellrosa Kutte; sie trug die grauen Haare kurz geschoren, ihr Lachen und ihre weichen Gesichtszüge verbargen ihr Alter. Amy und sie kannten sich offenbar gut, aber sie begrüßte mich nicht weniger herzlich. Wir folgten ihr hinter das Hauptgebäude zu einem Gästehaus. Schwer atmend stieg sie in den ersten Stock und brachte uns auf unsere Zimmer.
Mein Raum war vielleicht acht Quadratmeter groß, es gab ein Bett, einen Stuhl und einen kleinen Schrank. Auf dem Nachttisch stand ein Buddha aus hellem Holz, dahinter steckte in einer Vase eine rote Hibiskusblüte aus Plastik. An der Wand hingen ein Bild des meditierenden Buddha und eine Tafel mit einer seiner Weisheiten: »Kein Leid kann denen widerfahren, die nie versuchen, Menschen und Dinge als ihr Eigentum zu besitzen.«
Mir kam mein Bruder in Burma in den Sinn. Hatte er diesen Satz verinnerlicht und konnte deshalb so gelassen bleiben? Trotz der Armut, in der er lebte?
Die Nonne führte uns auf den Flur, zeigte uns, wo Toilette und Dusche lagen. Im Erdgeschoss gebe es eine Gemeinschaftsküche, die Vorräte im Kühlschrank und in den Schränken seien für alle da. Es würden noch fünf andere Gäste im Haus wohnen. Wenn wir wollten, könnten wir in einer Stunde an der gemeinsamen Meditation teilnehmen, die jeden Nachmittag um vier Uhr stattfinde. Um sechs gebe es Abendessen, und wie bei allen Aktivitäten sei die Teilnahme freiwillig.
Amy wollte mit ihr vor der Meditation einen Tee trinken, mir war nicht danach.
Ich stellte meinen Rucksack ab, schloss die Tür und öffnete das Fenster.
Eine Welt ohne Polizeisirenen. Ohne Autos. Ohne Musik aus der Nachbarwohnung.
Eine Stille ohne Stimme.
Sie war seit unserer Abfahrt aus New York verstummt. So lange hatte sie seit Tagen nicht geschwiegen. Warum sagte sie plötzlich nichts mehr?
– Hallo? Zaghaft. Zaghafter.
– Wo bist du?
Keine Antwort.
Ich legte mich
Weitere Kostenlose Bücher