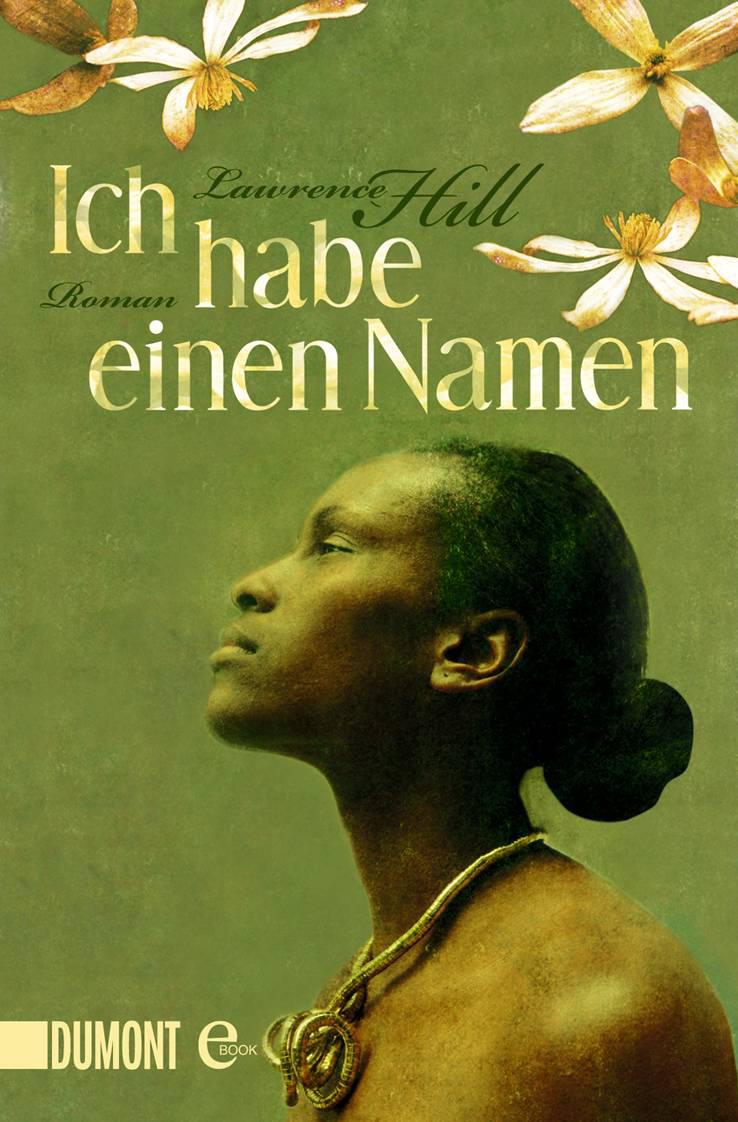![Ich habe einen Namen: Roman]()
Ich habe einen Namen: Roman
zu dem Augenblick,
da ich mich zum letzten Mal aus Mrs Lindos Schlafzimmer entschuldigt hatte,
hätte ich mir nie vorstellen können, einmal den Tod eines weißen Menschen zu
beklagen. Niemals hätte ich gedacht, dass mein Innerstes für einen oder eine
von ihnen bluten könnte.
Solomon Lindo hatte
eine Woche lang jeden Tag Leute aus der Synagoge im Haus, und noch einen
weiteren Monat bekam er fast täglich Besuch. Frauen aus seiner Gemeinde
brachten jede Art von Essen, und seine Schwester, eine kleine, strenge Frau
namens Leah, die sich durch meine bloße Anwesenheit beleidigt zu fühlen schien,
patrouillierte immer wieder durch das Haus.
Ein paar Wochen nach
Mrs Lindos Tod waren Mr Lindo und ich unversehens einen seltenen Augenblick
allein miteinander. »All diese Leute immer«, sagte er. »Es erdrückt einen.«
Aber wenigstens hatte
er diese Menschen, mit denen er sein Brot teilen und weinen konnte. Ich hatte
niemanden.
Die Leute in
Charles Town machten harte Zeiten durch. Münzen waren seltener denn je zu
bekommen, und die englische Regierung hatte ein Gesetz erlassen, das den
Gebrauch von Papiergeld in Süd-Carolina verbot. Die Menschen waren so wütend
darüber, wie die Engländer den Handel und Verkauf von Tee kontrollierten, dass
sie große Mengen auf den Docks von Charles Town verrotten ließen und sich
weigerten, überhaupt noch Tee zu trinken. Lindo und seine Freunde gaben den
Engländern die Schuld an ihren Problemen und warnten vor einem Krieg, wenn sich
die Lage nicht verbesserte. Lindo hatte mir erklärt, dass der Indigo aus
Carolina kaum noch die Hälfte des Preises erzielte, der für guatemaltekischen
Indigo und den aus der französischen Karibik bezahlt wurde. Die
Plantagenbesitzer, sagte er, überlegten, ob sie nicht andere Dinge anbauen
sollten. Und um das alles noch zu verschlimmern, hielten Fieber, Syphilis und
Pocken die Menschen in ständiger Angst und Aufregung. Charles Towner fürchteten
sich oft davor, anderen die Hand zu geben oder auch nur das Haus zu verlassen,
und um die Ausbreitung weiterer Krankheiten zu verhindern, verwehrte die
Stadtverwaltung eine Zeit lang sogar Sklavenschiffen die Landung auf Sullivan’s
Island.
Im Januar 1775, einige
Monate nach der Pockenepidemie, erklärte mir Solomon Lindo, dass er für einen
Monat geschäftlich nach New York City müsse, wo er die Engländer davon zu
überzeugen hoffe, die Exportprämien für Indigo aus Carolina festzuschreiben. Er
sagte, der Schlamm zum Färben verkaufe sich international so schlecht, dass die
Produktion in Carolina zum Stillstand kommen könne, sollten die englischen
Subventionen reduziert oder ganz abgeschafft werden.
Lindo reiste ab, und
seine Schwester Leah zog ins Haus. Aber sie aß allein und kümmerte sich nicht
darum, dass auch ich etwas bekam.
»Es gibt nichts zu
essen«, sagte ich am Tag, nachdem Lindo abgesegelt war, zu ihr.
»Arbeitest du nicht?«,
sagte sie.
»Doch.«
»Dann kannst du dich
auch selbst verpflegen. Ich werde weder Zeit noch Geld für dich verschwenden,
und wenn ich es mitentscheiden kann, wird auch mein Bruder nichts mehr für dich
tun.«
Als ich später ins Haus
wollte, um ein paar der Bücher zu holen, die Mrs Lindo hinterlassen hatte,
weigerte sich Lindos Schwester, mir die Tür aufzuschließen. Ohne etwas zu lesen
und zu essen, wanderte ich täglich durch die Straßen und bettelte Frauen, die
ich auf dem Markt kennengelernt hatte, um Obst, Erdnüsse und etwas Fleisch an.
Abends kaufte ich manchmal etwas gegrillten Fisch, der hinter einem der
Gasthäuser verkauft wurde, wo weiße Männer nach Mulattinnen suchten.
Es war fast unmöglich,
noch an Münzen zu kommen, und auf den Märkten gab es selbst die kleinsten Dinge
nur noch im Tauschhandel. Ich dachte verzagt an die Lektionen, die Lindo mir
vor Jahren erteilt hatte. Wie sich herausstellte, hatte ich recht gehabt.
Hühner waren verlässlicher als Silber. Ich selbst bekam nur selten welche und
tauschte alles ein, was ich von den Juden und Anglikanern bekam, wenn ich ihnen
oder ihren Sklavinnen Hebammendienste leistete.
Einige der Mütter
bezahlten mich mit kleinen Mengen Rum, und eine reiche Frau gab mir eine Kiste
mit fünfzig Glasfläschchen. Erst fühlte ich mich betrogen. Was sollte ich mit
einer Kiste leerer Flaschen anfangen? Aber als ich sie mir zu Hause näher
ansah, stellte ich fest, dass das Glas von ganz außerordentlicher Schönheit
war, eingefärbt mit herrlichen blauen Farbwirbeln. Die winzigen Flaschen
fassten
Weitere Kostenlose Bücher