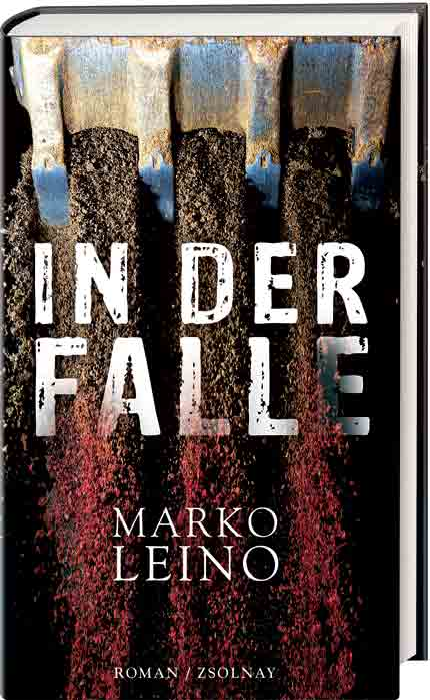![In der Falle - Leino, M: In der Falle]()
In der Falle - Leino, M: In der Falle
konnte. Er hatte mit allem Geld gemacht, vom Waffenhandel bis zur Prostitution, wobei das Drogengeschäft immer an erster Stelle gestanden hatte. Inzwischen besaß er die Mittel, ganz legal Firmen zu gründen, die nicht einmal mehr gewaschenes Geld brauchten, um auf eigenen Füßen zu stehen. Demirchyans legales Firmenkonglomerat musste ihm mindestens so viel einbringen wie seine kriminellen Geschäfte. Der Öffentlichkeit galt er als geschickter Unternehmer, der auf mehreren Gebieten geradezu märchenhaft erfolgreich war – und tatsächlich war er das ja auch. Aber warum spielte er dann weiter, riskierte er, früher oder später doch ertappt zu werden, weil jemand nicht dicht hielt oder ihm den Platz streitig machen wollte? Oder jemand legte ihn um. Damit musste er doch jederzeit rechnen. Warum machte es Demirchyan nicht wie Kornilov? Oder wie Boris Berezovski? Jetzt hätte er sich noch in Ehren zurückziehen können, in aller Ruhe, und wenn jemand fragte, könnte er wahlweise die politische Treibjagd gegen Menschen wie ihn oder die schlechte Stimmung im Land für seinen Weggang verantwortlich machen. Demirchyan war ja nicht einmal ein echter Russe, obwohl er irgendwann die Nationalität gewechselt hatte, es hielt ihn also nichts zurück. Würde sich Demirchyan wirklich als Russe fühlen, müsste er mit einem Glas Stolichnaya auf die Karibik schauen, nicht mit schlechtem armenischen Cognac aufs Schwarze Meer.
»Und der Zeitpunkt für die echten Transporte?«, fragte Koljakov, während er sein Glas hob.
»Hab ich noch nicht entschieden«, antwortete Demirchyan.
»Wann bekomme ich Bescheid?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Demirchyan. »Vielleicht erzähle ich es nicht mal dir«, fuhr er fort. Koljakov war es, als schraubte sich Demirchyans Blick tief in seinen Kopf, obwohl er die Augen hinter der spiegelnden Brille immer noch nicht sehen konnte. Dann wandte sich Demirchyan ab und lachte.
Koljakov nippte an seinem Cognac und musste an das armenische Sprichwort denken, das Demirchyan bei ihrem ersten Treffen in Moskau zitiert hatte. Es war eine Art Einstellungsgespräch gewesen, an dessen Beginn er noch Jevgeni Markov gewesen war, ein Berufskrimineller, der bei der Moskauer Solntsevskaya bratva rasch in die mittlere Etage aufgestiegen, dort aber sehr zu seinem Leidwesen stecken geblieben war. Noch am selben Abend war er Vladimir Koljakov geworden, in St. Petersburg geboren und dort seither auch wohnhaft. Aus der Solntsevskaya konnte man nicht austreten, also hatte Markov sterben müssen. Im Tausch gegen die neue Identität mit in jeder Hinsicht vollständigen Papieren erhielt Demirchyan, zusätzlich zu seinem neuen Mitarbeiter, eine Reihe von Dokumenten, die man benötigte, wenn man die Führungsebene der Tambov, der einflussreichsten St. Petersburger Verbrecherorganisation, in Schwierigkeiten bringen wollte. Koljakov hatte die Dokumente in seiner Zeit bei der Solntsevskaya nach und nach zusammengetragen. Der Handel war für beide ausgesprochen profitabel: Koljakov konnte sich von der Solntsevskaya lösen, und Demirchyan bekam St. Petersburg auf dem Tablett serviert.
»Die einen essen, um zu leben, aber die Armenier leben, um zu essen«, hatte Demirchyan nach dem Tausch der Aktentaschen in einem Nobelrestaurant gesagt.
Damals hatte Koljakov den Spruch nur auf die Delikatessen der armenischen Küche bezogen, unter denen sich der Tisch in dem Restaurant bog. Jetzt begriff Koljakov, dass Demirchyan nicht nur das Essen gemeint hatte. Er hatte auch von dem ewigen Hunger gesprochen, der ihn in allen Dingen vorwärtspeitschte. Demirchyan würde sich nie wie Kornilov verhalten: Demirchyan würde niemals vom Tisch aufstehen, sondern so lange weiteressen, wie es zu essen gab, und danach würde er an den Nachbartisch wechseln, denn einer wie er wurde niemals satt, er lebte, um zu essen, genau wie es das armenische Sprichwort besagte.
»Trauerst du manchmal den alten Zeiten nach, Kolja?«, fragte Demirchyan, den Blick aufs Meer gerichtet.
»Wie?«
»Deinem alten Leben, deinem alten Namen, deinen alten Beziehungen – trauerst du ihnen manchmal nach?«
»Nein«, antwortete Koljakov, und genauso war es. Er trauerte den alten Zeiten nicht nach, nicht Moskau, nicht der Solntsevskaya und am wenigsten Jevgeni Markov. Für ihn war Markov wirklich an dem Tag gestorben, an dem er zu Vladimir Koljakov geworden war. Er hatte Markov von Anfang an nicht gemocht. Koljakov gefiel ihm besser. Noch besser gefiel ihm nur sein richtiger
Weitere Kostenlose Bücher