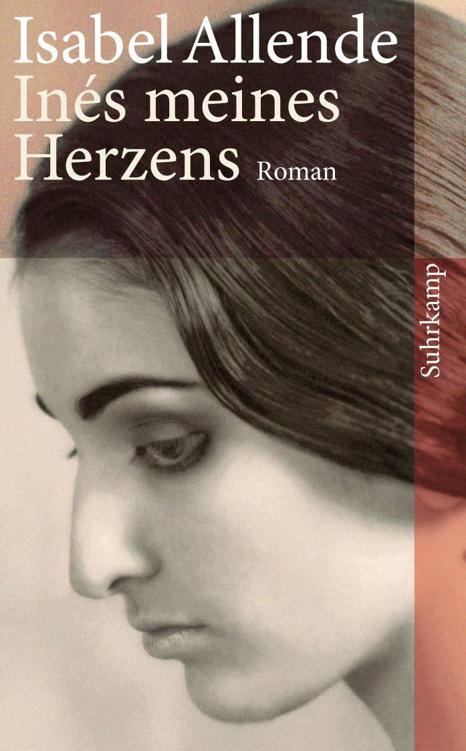![Inés meines Herzens: Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)]()
Inés meines Herzens: Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)
schiere Not trieb sie dazu, das Fleisch ihrer Nächsten zu essen. Gott muß wissen, daß diese Unglücklichen es nicht taten, weil sie Sünder sind, sondern weil sie Hunger litten. Ein Chronist, der an den Feldzügen des Jahres 1555 teilnahm, schreibt, die Indios hätten Menschenstücke gekauft, wie man Stücke von Lamafleisch kauft. Der Hunger … wer ihn nicht erlebt hat, hat kein Recht zu richten. Rodrigo de Quiroga erzählte mir, in der Hölle der heißen Wälder der Chunchos hätten die Indios der Hilfstruppe ihre eigenen Kameraden gegessen. Sollten auch die Spanier in ihrer Not diese Sünde begangen haben, so erwähnte er das nicht. Aber Catalina versicherte mir in diesen schlimmen Jahren, daß die Viracochas sich nicht von anderen Sterblichen unterscheiden, einige würden die Toten ausgraben, um ihre Schenkel zu braten, und gingen zum selben Zweck im Tal auf die Jagd nach Indios. Als ich das Pedro gegenüber verlauten ließ, hieß er mich, bebend vor Entrüstung, zu schweigen, weil er einen Christenmenschen einer solchen Niedrigkeit für nicht fähig hielt; da mußte ich ihn daran erinnern, daß er dank mir etwas besser aß als alle anderen in der Kolonie und folglich still sein sollte. Man mußte ja nur die irrsinnige Freude sehen, wenn es einem gelang, am Ufer des Mapocho eine Ratte zu fangen, um zu begreifen, daß auch Kannibalismus nicht ausgeschlossen war.
Felipe oder Felipillo, wie der kleine Mapuche von den meisten genannt wurde, folgte Pedro auf Schritt und Tritt und war in der Stadt zu einer vertrauten Erscheinung geworden, zum Maskottchen der Soldaten, die darüber lachten, wie er die Gesten und die Stimme des Gouverneursnachahmte, was er nicht zum Spott tat, sondern aus Bewunderung. Pedro ließ es sich nicht anmerken, aber ich weiß, daß die stille Aufmerksamkeit und der Diensteifer des Jungen ihm schmeichelten: Felipe polierte Pedros Rüstung mit Flußsand, schliff seinen Degen, wichste sein Sattelzeug, wenn er etwas Fett bekommen konnte, und kümmerte sich vor allem um Sultán wie um einen Bruder. Pedro behandelte den Jungen mit diesem wohlwollenden Gleichmut, den man einem treuen Hund entgegenbringt; er mußte kaum je das Wort an ihn richten, Felipe las seinem »Taita« jeden Wunsch von den Augen ab. Von einem der Soldaten ließ Pedro den Jungen im Umgang mit der Arkebuse unterweisen, »damit er die Frauen im Haus verteidigt, wenn ich nicht da bin«, sagte er, was mich kränkte, weil bisher doch stets ich es gewesen war, die nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer verteidigt hatte.
Felipe war ein stiller Junge, saß oft stundenlang da wie ein greiser Mönch, rührte sich nicht und schaute nur. »Er ist faul, das liegt denen im Blut«, hieß es dann. Für ihn waren die Unterrichtsstunden in Mapudungu eine schier unerträgliche Zumutung – er verachtete mich dafür, daß ich eine Frau war –, für mich hingegen eine Gelegenheit, vieles von dem zu erfahren, was ich über die Mapuche weiß. Für die Mapuche sorgt die heilige Erde, sie nehmen sich, was sie brauchen, und danken dafür. Sie nehmen nicht mehr und häufen nichts an. Arbeit ist ihnen unbegreiflich, weil es kein Morgen gibt. Wozu soll Gold gut sein? Die Erde gehört niemandem, das Meer gehört niemandem; allein der Gedanke, beides besitzen oder verteilen zu wollen, brachte den sonst so düsteren Felipe zum Lachen. Die Menschen gehören auch niemandem. Wie können die Huincas Leute kaufen und verkaufen, die doch nicht ihr Besitz sind? Manchmal sagte der Junge zwei oder drei Tage lang kein Wort, war verdrießlich und aß nichts, und wenn man ihn fragte, was mit ihm sei, sagte er immer dasselbe: »Es gibt frohe Tageund traurige Tage. Jeder ist Herr über sein Schweigen.« Er vertrug sich nicht gut mit Catalina, die ihm nicht über den Weg traute, aber die beiden erzählten einander ihre Träume, denn für sie stand die Tür zwischen dem Leben bei Tag und dem bei Nacht stets offen, und durch Träume sprach ihre Gottheit zu ihnen. Nicht auf seine Träume zu hören bringe Verderben, versicherten sie. Felipe ließ sich jedoch nie von Catalina seine Zukunft aus den Muscheln und Perlen lesen, die ihm eine abergläubische Furcht einjagten, und auch um ihre wirkmächtigen Kräuteraufgüsse machte er einen Bogen.
Unseren Indios war das Reiten eigentlich unter Androhung der Peitsche verboten, aber Felipe hatte man es ausnahmsweise erlaubt, weil er die Pferde fütterte und behutsam zu bändigen verstand, indem er leise auf sie einredete. Er
Weitere Kostenlose Bücher