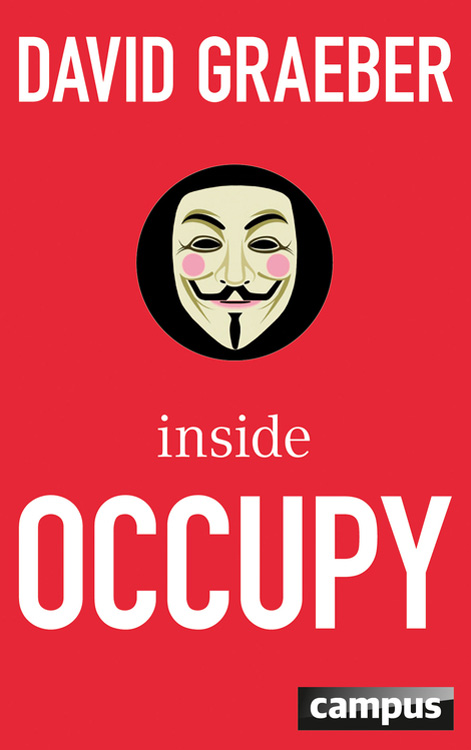![Inside Occupy]()
Inside Occupy
entscheidenden strategischen Erfordernisse scheint es mir zuweilen unerlässlich zu sein, Beziehungen zu Regimen mit zweifelhafter Menschenrechtsbilanz zu unterhalten, ja, sie sogar zu unterstützen.«
»Im Interesse unserer entscheidenden strategischen Erfordernisse scheint es mir zuweilen unerlässlich zu sein, Beziehungen zu Regimen zu unterhalten, in denen vergewaltigt, gefoltert und gemordet wird, ja, sie sogar zu unterstützen.«
Wer so redet wie im zweiten Fall, dürfte sich sicher schwerer tun, sein Anliegen durchzubringen. Und wer immer diesen Satz hört, wird sich weit eher fragen, ob diese »strategischen Erfordernisse« tatsächlich so »entscheidend« sind. Wird sich womöglich gar fragen, was denn überhaupt ein »strategisches Erfordernis« sei.
Ich für meinen Teil halte diesen »Vergewaltigungs-Folter-Mord-Test«, wie ich ihn nenne, für recht nützlich. Weil er das Verfahren vereinfacht. Hat man ein politisches Gebilde vor sich – sei es ein Staat, eine soziale Bewegung, eine Guerillaarmee, ja, irgendeine organisierte Gruppe, die einen vor die Entscheidung stellt, ob man sie unterstützen oder verurteilen soll –, frage man sich zuerst: »Vergewaltigt, foltert oder mordet es oder gibt entsprechende Befehle dazu?« Die Frage scheint auf der Handzu liegen, aber einmal mehr erweist es sich als überraschend, wie selten – oder besser, wie selektiv – man sie stellt. Oder vielleicht mag einem das als überraschend erscheinen, bis man sie stellt und dadurch die konventionelle Sichtweise so einiger weltpolitischer Probleme plötzlich auf den Kopf gestellt sieht. Somalische Piraten zum Beispiel haben bis 2009 weder vergewaltigt noch gefoltert noch gemordet (erst danach ging es mit einigen Banden rapide bergab) – was besonders beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass sie, um als Piraten ernst genommen zu werden, ihre potenziellen Opfer davon überzeugen mussten, sie würden es tatsächlich tun. Inzwischen ist fast jeder Staat in diesem Teil der Welt bei diesem Test mit spektakulären Resultaten durchgefallen. 17
In den USA jedoch ist Korruption das Tabu schlechthin. Es gab einmal eine Zeit, in der man es »Bestechung« nannte, Politikern Geld zuzustecken, um Einfluss auf sie zu nehmen, abgesehen davon, dass es illegal war. Die Hand aufzuhalten bezeichnet man heute als »Fundraising« bzw. »Spendensammeln« und die Bestechung selbst als »Lobbying«. Als Folge davon ist Bestechung zur eigentlichen Basis unserer Staatsform geworden. Um das zu kaschieren, haben wir diverse rhetorische Tricks – deren wichtigster darin besteht, einige wenige Praktiken weiterhin unter Strafe zu stellen. So können wir weiterhin darauf beharren, dass »richtige« Bestechung immer eine andere Form der Entgegennahme von Geld im Austausch für politisches Wohlwollen sei. 18 Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass der durchschnittliche Senator oder Kongressabgeordnete in Washington vom Tag seines Amtsantritts an Woche für Woche etwa 10 000 Dollar aufbringen muss, wenn er wiedergewählt werden möchte – Geld, das er fast ausschließlich von dem einen Prozent der Reichsten bezieht. 19 Was dazu geführt hat, dass unsere gewählten Volksvertreter geschätzte 30 Prozent ihrer Zeit darauf verwenden, sogenannte Spender um Bestechungsgeld anzugehen.
All das wurde zur Kenntnis genommen und diskutiert. Weniger Augenmerk richtete man bisher darauf, dass sich das mit der Moral des öffentlichen Lebens gleich ganz anders verhält, wenn man sich erst einmal im Prinzip auf die Akzeptabilität des Einflusserwerbs geeinigt hat. Anders gesagt: wenn man nichts Falsches mehr darin sieht, nicht nur die eigenen Angestellten, sondern grundsätzlich jeden, selbst die Renommiertesten und Mächtigsten, für Handlangerdienste in Wort und Tat zu bezahlen. Wenn Menschen, die im Dienste der Öffentlichkeit stehen, bestochen werden können, um Standpunkte zu vertreten, die einem passen, warum dann nicht auch Professoren? Wissenschaftler? Journalisten? Die Polizei?
Eine Menge dieser Verbindungen begannen in den ersten Tagen der Besetzung sichtbar zu werden: So stellte sich heraus, dass viele der uniformierten Polizisten im Finanzdistrikt, von denen man hätte glaubenmögen, sie seien im gleichen Maße zum Schutz aller Bürger da, in Wirklichkeit von Wall-Street-Firmen direkt bezahlt werden. Ähnlich gestand einer der ersten Reporter von der
New York Times
, die sich Anfang Oktober schließlich zu einem Besuch des Camps herabließen, ohne
Weitere Kostenlose Bücher