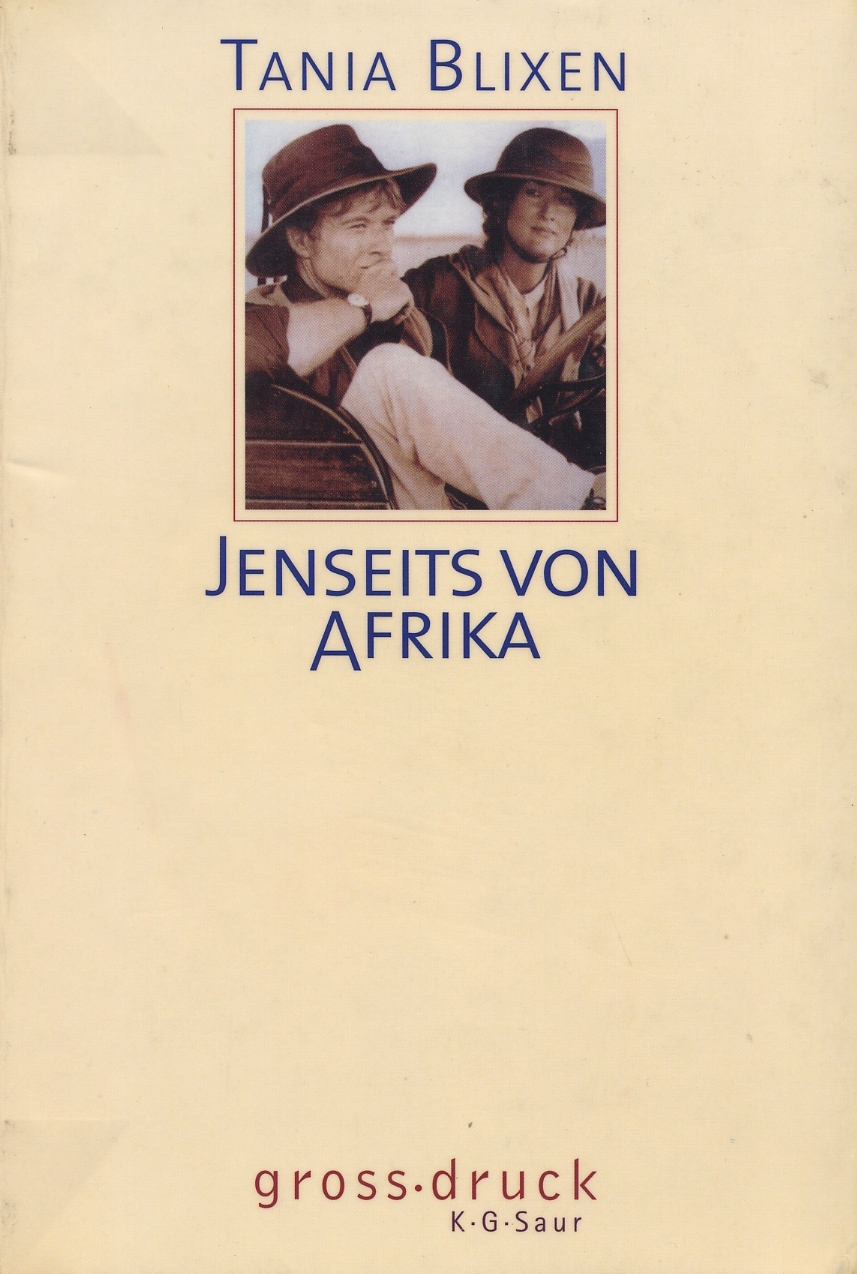![Jenseits von Afrika]()
Jenseits von Afrika
herauskollerten und die Backen hinunterliefen. Ich wußte, es waren reine Krokodilstränen, und bei einem anderen hätten sie mich gerührt. Aber bei Kamante war es etwas anderes. Sein plattes hölzernes Gesicht sank in solchen Augenblicken zurück in die Welt der Finsternis und abgründigen Verlassenheit, in der er, jung wie er war, viele Jahre gelebt hatte. Solch dumpfe schwere Tränen mag er als kleiner Bub in der Steppe bei seinen Schafen geweint haben. Sie verwirrten mich, und die Fehler, die ich ihm verwies, gewannen ein anderes Gesicht, so daß ich nicht weiter über sie reden mochte. Das hatte freilich etwas Demoralisierendes. Aber ich glaube, kraft der echten menschlichen Vertrautheit, die zwischen uns bestand, wußte Kamante in seinem Herzen, daß ich seine Tränen der Zerknirschung durchschaute und nicht für mehr hielt, als sie waren – ja, er selbst hielt sie wohl mehr für eine Zeremonie, die man den höheren Mächten schuldete, als für einen Versuch zu betrügen.
Er betonte häufig, daß er ein Christ sei. Ich wußte nicht, was er sich bei dem Namen dachte, und versuchte ein oder das andere Mal, ihn zu examinieren. Aber er erklärte, er glaube das, was ich glaube, und da ich ja wissen müsse, was ich glaubte, hätte es keinen Sinn, ihn auszufragen. Ich merkte, daß das mehr war als eine Ausrede; es war gewissermaßen ein positives Programm und Glaubensbekenntnis. Er hatte sich dem Gott der Weißen unterstellt. In seinem Dienst war er bereit, jeden Befehl zu befolgen, aber er hielt es nicht für seine Pflicht, einen Lebensplan zu ergründen, der am Ende ebenso unvernünftig sein konnte wie die Lebenspläne der Weißen selber. Zuweilen kam es vor, daß mein Verhalten den Lehren der schottischen Missionare, die ihn bekehrt hatten, widersprach; dann fragte er mich, wer recht habe.
Die Vorurteilslosigkeit der Schwarzen ist zutiefst befremdend, denn man erwartet eigentlich bei einem primitiven Volk, auf starre Tabubegriffe zu stoßen. Sie rührt, glaube ich, von der Bekanntschaft mit den verschiedenen Rassen und Völkern her und von den regen menschlichen Beziehungen, die Ostafrika erst durch die Elfenbein- und Sklavenhändler und in unserer Zeit durch die Siedler und Großwildjäger aufgenötigt worden sind. Beinahe jeder Schwarze, bis hinunter zu den Hirtenbuben der Steppe, hat im Laufe der Zeit schon mit einer ganzen Reihe von Nationalitäten Umgang gehabt, die für ihn so verschiedenartig sind wie für uns Sizilianer und ein Eskimo: mit Engländern, Juden, Buren, Arabern, Somali und Indern, Suaheli, Massai und Kavirondo. Hinsichtlich seiner Aufnahmefähigkeit für Ideen ist ein Schwarzer viel mehr Weltmann als ein Siedler aus der Vorstadt oder Provinz, der in einer gleichförmigen Umwelt mit einer Handvoll starrer Meinungen aufgewachsen ist – manches Mißverstehen zwischen Weißen und Schwarzen ist daraus zu erklären.
Es ist erschütternd, an sich selbst zu erleben, daß man den Schwarzen gegenüber als Person das Christentum vertritt.
Einmal kam ein junger Kikuju namens Kitau aus dem Kikujureservat und trat in meinen Dienst. Er war ein nachdenklicher Junge, ein umsichtiger, aufmerksamer Diener, und ich hatte ihn gern. Nach drei Monaten bat er mich eines Tages, ihm einen Empfehlungsbrief an meinen alten Freund, den Scheich Ali bin Salim, den Lewali des Küstengebietes in Mombasa, zu geben; er habe ihn in meinem Hause gesehen, sagte er, und wolle jetzt zu ihm gehen und für ihn arbeiten. Ich hatte keine Lust, Kitau gehen zu lassen, nachdem er sich gut eingearbeitet hatte, und sagte, ich wolle lieber seinen Lohn aufbessern. Nein, sagte er, er gehe nicht fort, um mehr Lohn zu bekommen, aber er könne nicht länger bleiben. Er erzählte, er sei daheim im Reservat zu dem Entschluß gekommen, entweder Christ oder Mohammedaner zu werden, habe aber nicht gewußt, was er wählen sollte. Darum sei er zu mir gekommen und habe bei mir gearbeitet, weil ich eine Christin sei, und sei drei Monate bei mir geblieben, um die »desturi« – die Art und Sitte – der Christen kennenzulernen. Von mir wolle er auf drei Monate zum Scheich Ali nach Mombasa gehen, um die »desturi« der Mohammedaner kennenzulernen, und danach wolle er entscheiden. Ich glaube, sogar ein Erzbischof, dem dieser Sachverhalt offenbart worden wäre, hätte gesprochen oder mindestens gedacht wie ich: Mein Gott, Kitau, das hättest du mir doch sagen können, als du eintratst.
Mohammedaner essen kein Fleisch von einem Tier, dessen Kehle
Weitere Kostenlose Bücher