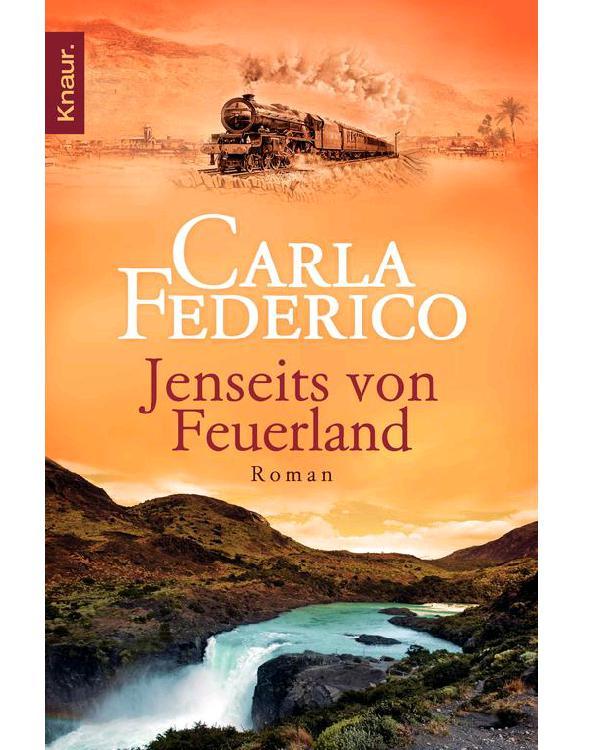![Jenseits von Feuerland: Roman]()
Jenseits von Feuerland: Roman
sie nun trotzdem: Der Mann stöhnte in einem fort, begann schließlich, sich wieder zu erbrechen, und seine Hose färbte sich bräunlich vom vielen Durchfall, der zuletzt dünnflüssig wie Reiswasser aussah. Einmal versuchte er, sich zu erheben, doch kaum hatte er sich mit ihrer Hilfe mühsam aufgerappelt, brach er wieder zusammen.
Endlich eilte ein Arzt herbei.
»So tun Sie doch etwas für ihn!«, rief Emilia.
»Das Blut beginnt sich bereits zu verdicken«, erklärte der Arzt und blickte düster auf ihn.
Emilia begriff nicht, was er meinte, sah nur, dass die Haut des Unglückseligen sich noch bläulicher verfärbt hatte und zugleich Wellen warf, als bestünde sie aus Wachs und würde unter einer Flamme schmelzen. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen und blickten stumpf auf sie, die Hände und Füße waren eiskalt. Eine Weile lag er so still, als wäre er schon tot, dann erbebte sein Körper unter erneuten Krämpfen. Gemartert schrie der Mann auf.
»Wie kann man ihm helfen?«, fragte Emilia ratlos.
»Cholerakranke trocknen innerlich aus«, erklärte der Arzt, und durch seine Stimme klang kein Mitleid, »wenn sie nicht rechtzeitig Flüssigkeit bekommen, versagen Herz und Nieren. Für diesen hier ist es wahrscheinlich schon zu spät. Die Hälfte können wir retten – die andere Hälfte nicht.«
So schlimm und endgültig dieses Urteil auch klang, keimte in Emilia dennoch Hoffnung auf, als sie hörte, dass die Krankheit nicht für jeden tödlich war.
Der Arzt trat zurück, und an seiner statt machten sich Schwestern an dem Unglückseligen zu schaffen. Emilia beugte sich vor, um zu sehen, was sie taten, und erkannte eine spitze Nadel, die man ihm in die Armbeuge stach – offenbar, um ihm eine Infusion zu verabreichen.
Als man ihn auf eine Trage hievte und in das Krankenhausgebäude schaffte, überlegte Emilia, zurück ins Varieté zu kehren. Doch zum einen kannte sie den Weg nicht, zum anderen wollte sie den Mann – auch wenn er ein Fremder war – nicht alleine sterben lassen. Sie folgte ihm in einen Saal, wo mehrere Dutzend Pritschen dicht nebeneinanderstanden, die meisten von ihnen waren belegt. Der Gestank nahm Emilia schier den Atem, doch sie bemühte sich, durch den Mund zu atmen, nicht durch die Nase, während man den Mann fürs Erste versorgte und auf ein Bett legte. Sie konnte sich nicht überwinden, seine Hand zu nehmen, setzte sich trotzdem zu ihm, um ihm inmitten von Fieber- und Schmerzenspein immer wieder zu vergewissern, dass er nicht alleine war. Der Morgen graute, als er zu trinken verlangte.
Sie machte sich auf die Suche, schritt durch weitere Krankensäle und begann sich in den vielen Gängen und Räumen zu orientieren – nur Wasser fand sie nicht. Die Ärzte und Schwestern liefen an ihr vorbei und antworteten nicht auf ihre Fragen, sondern waren hektisch bemüht, immer mehr Kranke zu versorgen, die gebracht wurden. Erst glaubte Emilia, ihnen am besten zu helfen, wenn sie ihnen aus dem Weg ging – dann erkannte sie, dass manche in Hast und Panik den Überblick verloren hatten, und griff ein.
»Dort sind noch drei Betten frei!«, deutete sie auf einen der Säle, wenn wieder Kranke die Treppe hochgebracht wurden, und nachdem sie erst einmal angefangen hatte, Helfer und Schwestern zu dirigieren, fuhr sie damit fort. Ihre Stimme verhieß den Klang einer, die zu befehlen gewohnt war, und die meisten richteten sich nach ihren Worten, ohne sich zu überlegen, warum sie sich anmaßte, Betten zuzuweisen.
Die Sonne erhob sich längst weit über den Morgendunst, als sie immer noch im Eingangsbereich stand und zu helfen versuchte. Mittlerweile konnte sie die verschiedenen Phasen der Krankheit unterschieden: Mit Übelkeit und dem Gefühl von Taubheit begann sie, und wer dann schon behandelt wurde, war leicht zu retten. Dann gab es solche, die bereits vor Schmerzen schrien und deren Körper auszurinnen schienen wie ein Schlauch Wein. So unerträglich der Gestank war, der von ihnen ausging – wenn man den Betreffenden ausreichend Flüssigkeit einflößte, konnten sie überleben. Verloren hingegen waren die, die schon in Apathie versunken waren.
Emilia begriff zudem, dass diese Phasen oft rasch aufeinander folgten. Dem Gemurmel um sich herum entnahm sie, dass es kaum eine Krankheit gab, die so schnell tötete wie der »Blaue Tod«. Einige schafften es drei, vier Tage – viele aber starben nur wenige Stunden nach Ausbruch.
Eine Frau behauptete laut weinend, ihr Mann wäre von der Arbeit
Weitere Kostenlose Bücher