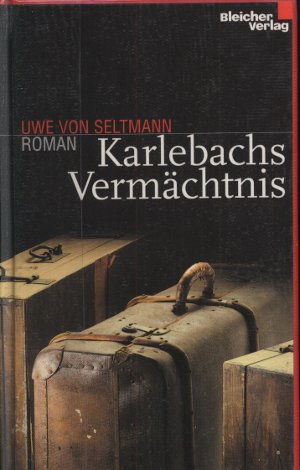![Karlebachs Vermaechtnis]()
Karlebachs Vermaechtnis
Eltern wollen etwas vor dir verheimlichen?«
»Ich weiß es nicht.« Ich erzählte ihr von der Bibel und dem Briefumschlag, der aus dem Ledereinband gefallen war. »Könntest du mal nachschauen«, schloss ich meinen Bericht, »ob du das Original findest?« Deborah schwieg.
Ich küsste sie auf die Lippen. »Mir zuliebe, bitte.«
»Das kann ich doch nicht machen«, murmelte sie, »auch nicht dir zuliebe.«
»Wo steckt denn der Axel wieder?«, fragte ich ärgerlich. Ich pfiff und rief seinen Namen, aber der Köter tauchte nicht auf. Statt Axel baute sich plötzlich Oleander vor mir auf. Mit hochrotem Kopf.
»Oleander«, wollte ich seinem Zornesausbruch zuvorkommen, »hast du vielleicht meinen Axel gesehen. Er muss sich irgendwo zwischen deinen Gräbern verirrt haben.« Wenn Oleander wütend war, stotterte er. »Fffür Huhunde ist hihier Zuzuzutritt verboten!« Er fuchtelte mit seinem Spaten. »Ich ich ich hähätte ihn erschlagen sollen, erschlagen!«
»Oleander«, besänftigte ich ihn, »was hat er denn angestellt?«
Oleander beruhigte sich wieder. »Ich hab ihn in die Kapelle gesperrt. Ich schaufelte in meinem neuen Grab, da ist er reingehüpft. Einfach rein.«
»Und dann?«
»Dann hat er angefangen zu buddeln. Und alles durcheinander gebracht.«
»Entschuldige bitte, Oleander. Er wollte dir sicher nur helfen.«
»Helfen?«
»Ja, damit du früher Feierabend machen kannst.« Oleander kratzte sich am Kopf. »Aber sehr geschickt hat er sich dabei nicht angestellt.«
Ich drückte ihm einen Fünfer in die Hand. »Für ein Bier! Und jetzt lass den Axel wieder frei.«
Auf unserem Spaziergang versuchte ich noch einmal, Deborah davon zu überzeugen, das Originaltestament zu suchen. Ich redete mit Engelszungen auf sie ein, aber sie ließ sich nicht erweichen. Sie könne ihre Eltern nicht hintergehen, meinte sie, das sei doch Sünde. Ich erklärte ihr, dass es keine Sünde sei, wenn man eine kleine Sünde begehe, um eine viel größere aufzudecken oder zu verhindern. Mit meinen theologisch wohl durchdachten Spitzfindigkeiten stieß ich jedoch auf taube Ohren. Auch Axel, der Deborah mit seinem treuesten Hundeblick herzerweichend anschaute, konnte sie nicht umstimmen. Sie blieb dabei: Auch mir zuliebe sei sie nicht bereit, gegen das Gebot der Elternliebe zu verstoßen.
7
Es war Tradition, dass wir am Heiligabend mit dem Posaunenchor durch Merklinghausen zogen und Choräle bliesen. Pietsch, dessen Mandat es ihm zu dirigieren erlaubte, war dieses Jahr besonders eifrig. »Wir spielen zusätzlich bei allen, die über fünfundsiebzig sind«, kündigte er an.
Dann seien wir ja stundenlang unterwegs, maulten einige, aber Pietsch ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. »Zu Weihnachten hat jeder eine kleine Freude verdient«, erklärte er mit Politikerstimme, »besonders unsere Alten, die viel für uns und unser Vaterland getan haben.« Alle, die unserem Chor zuhörten, beglückte Pietsch mit einem kleinen Büchlein. Seine achtjährige Tochter, ein verzogenes, ewig nörgelndes und nervendes Biest, unterstützte ihn dabei.
»Moment mal«, sagte ich nach ungefähr einer Stunde. Wir hatten uns in der Dorfmitte vor Fricks Bürohaus postiert, gegenüber der Sonne. Als ich eine kleine Erholungspause einlegen musste, bekam ich mit, mit welchen Worten Pietsch und seine Tochter die Präsente überreichten. Zu jedem »Ein kleines Geschenk für Sie, im Namen des Posaunenchors« fügten sie hinzu: »Und im Namen unserer christlichen Partei.«
»Keinen Wahlkampf«, sagte ich kategorisch und legte mein Horn beiseite.
Einige, wie mein Kumpel Andi, unterstützten mich, anderen, wie meinem Bruder, musste ich das Vorgefallene erst umständlich erklären, wiederum andere fanden gar nichts Besonderes dabei, denn der Posaunenchor und die Partei seien schließlich beide christlich. Es kam zu einer Grundsatzdiskussion, die durch Pietschs Hang zum Brüllen in einen lautstarken Streit ausartete. Oberkirchenrat Knecht, Flügelhornbläser in der zweiten Stimme, versuchte zu vermitteln, denn einige weihnachtlich gestimmte Spaziergänger waren bereits stehen geblieben und hörten mit Interesse zu, aber die Fronten hatten sich verhärtet. Die Auseinandersetzung eskalierte, als Onkel Kurt, mit fast achtzig Jahren der älteste Bläser und seit Lebzeiten Sozialdemokrat, Pietsch vorwarf, er sei ja fast so schlimm wie sein Vater. Einige von uns Jüngeren fragten neugierig nach. »Hier, wo wir jetzt stehen, stand früher das Judenhaus«,
Weitere Kostenlose Bücher