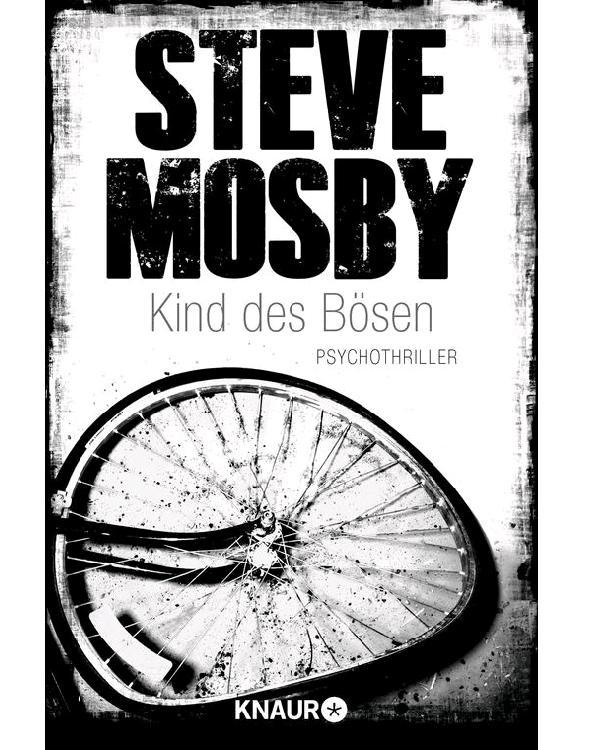![Kind des Bösen: Psychothriller (German Edition)]()
Kind des Bösen: Psychothriller (German Edition)
konnte. Die Küche jedenfalls würde sie erst als Letztes anderen überlassen. Und im Hinblick auf meine Kochkünste war das vermutlich für uns beide auch gut so.
»Es duftet phantastisch«, sagte ich.
»Danke.«
Ich griff nach der Evening Post.
Vicki Gibson war der Aufmacher auf der Titelseite, mit einem Farbfoto auf der rechten Seite, das ihr lächelndes Gesicht zeigte. Man kann über Reporter sagen, was man will, aber in diesem Fall waren sie erstaunlich schnell gewesen. Wir hatten ihre Identität noch gar nicht preisgegeben, auch wenn ich annahm, dass es nicht allzu schwer gewesen sein dürfte, sie Nachbarn oder dem ein oder anderen Polizisten am Tatort zu entlocken, der sich die Presse gern gewogen hielt.
Ich überflog den Artikel. Das zweite Opfer, das wir gefunden hatten, wurde nicht erwähnt. Entweder war es für die Meldung schon zu spät gewesen, oder sie war für den Augenblick als nicht wichtig genug eingestuft worden. Auch Tom Gregory tauchte zum Glück nicht auf. Es folgte lediglich der stereotype Hinweis, dass wir Hinweisen nachgingen. Ich wünschte, es würde stimmen. Mein Name wurde nur am Rande genannt als derjenige, der die Ermittlungen leitete, mit einer Telefondurchwahl ins Revier, die aber zum Glück nicht meine war. Danke auch für dieses Geschenk.
Ich legte die Zeitung wieder zurück und ging durch die Küche.
Mit dem Rücken zu mir stand Rachel vor der Arbeitsplatte, in das Schneiden und Hacken von Gemüse vertieft. Mit der Messerkante schob sie die gewürfelten Paprikaschoten vom Schneidebrett in die zischende Bratpfanne neben ihr.
Ich sah ihr eine Weile einfach nur zu. Das braune Haar hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zurückgebunden. Ihr Nacken war am Blusenansatz blass und leicht gesprenkelt. Ab und zu blitzte eine Reflexion an der Seite ihrer dicken schwarzen Brille auf.
Tock, tock, tock.
Jetzt schnitt sie Pilze, schien mich nicht zu bemerken oder tat zumindest so.
Die vierunddreißigste Schwangerschaftswoche war ihr fast nicht anzusehen. Sie hatte in den ersten paar Monaten nicht viel zugenommen, und selbst jetzt, wo ihr Bauch sich deutlich wölbte, war es von hinten kaum zu bemerken.
Abgesehen von einem gelegentlichen leisen Stöhnen und den Schlafstörungen merkte man ihr die Schwangerschaft auch sonst nicht an. Rachel war immer schon sehr belastbar gewesen. Nichts schien sie aus der Ruhe zu bringen. Eine praktische, zupackende Person. Ihre Schwangerschaft nahm sie mit derselben Gelassenheit hin wie alles andere auch, unbegreiflich abgeklärt angesichts der Tatsache, dass sie jetzt ein Kind in sich trug und es schon bald da sein würde. Dass es eine enorme Verantwortung sein würde, uns zu kümmern, für es zu sorgen, es zu formen.
Im Gegensatz zu mir schien sich Rachel über all das keine Sorgen zu machen. Natürlich, wenn sie das Baby allein aufziehen müsste, würde sie es tun, und das wahrscheinlich sogar sehr gut. So weit waren unsere Überlegungen während der letzten Monate gediehen, als es zwischen uns immer schwieriger geworden war. Als wir auseinanderdrifteten, uns immer mehr von der festen Einheit entfernten, die wir stets gebildet hatten.
»Ich spüre, dass du hinter mir stehst«, sagte sie.
»Ach ja?«
»Ja, es kitzelt im Nacken.«
»Du warst immer schon kitzlig.«
Eine ziemlich dumme Bemerkung, denn genau das Gegenteil war der Fall. Ich war kitzlig. Sie war – zu meinem Verdruss – absolut immun. In glücklicheren Zeiten hatte sie es fertiggebracht, mich hilflos auf dem Boden oder auf dem Bett zurückzulassen, wenngleich diese unbeschwerte Zweisamkeit jetzt undenkbar war. Eigentlich hatte ich nur irgendetwas sagen wollen, und diese Verkehrung ins Gegenteil hätte früher ein Lächeln über ihr Gesicht huschen lassen, ja, hätte sie vielleicht sogar angestachelt, mich zu widerlegen, ob nun gerade das Essen auf dem Tisch stand oder nicht. Das aber funktionierte heute Abend überhaupt nicht. Die Stille, die sich anschloss, war leer und verkrampft, als hätte ich sie gegen ihren Willen umarmen wollen.
Nach einer Weile fragte sie: »Woran denkst du?«
»Ich denke, dass du wunderbar bist.«
»Ach ja?«
»Ja. Glaubst du mir etwa nicht?«
Sie bearbeitete immer noch das Schneidbrett, ihre Schultern wiegten sich im Takt zu dem Messer, so dass ich kaum wahrnahm, wie sie mit den Schultern zuckte. Es tat weh, als ich es bemerkte. Gleichgültigkeit ist für mich immer noch schlimmer als offene Feindschaft. Denn Feindschaft bedeutet immerhin, dass es
Weitere Kostenlose Bücher