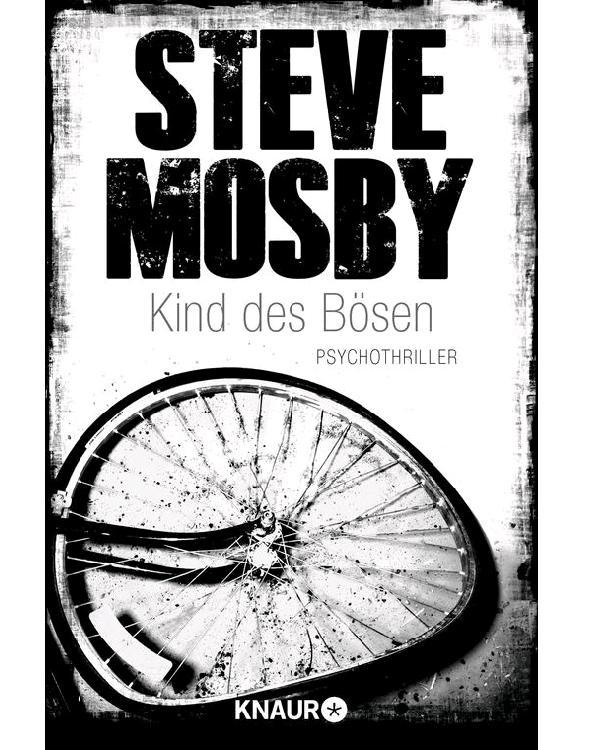![Kind des Bösen: Psychothriller (German Edition)]()
Kind des Bösen: Psychothriller (German Edition)
Armbanduhr.
»Also bleiben uns noch achtundsechzig Stunden, bis wir ihm etwas angehängt haben müssen. Wir behalten ihn einfach noch ein wenig hier.«
»Warum? Was soll das?«
»Weil ich ihn verdammt noch mal nicht ausstehen kann.«
Ich wandte mich ab und ging zur Tür.
»So ist es.«
5
D er General betrachtet sich im Badezimmerspiegel.
Sein kurzes Haar ist gekämmt und akkurat zurückgegelt, sein Gesicht ausdruckslos, aber ernst: das eines zupackenden Mannes. Nicht der Typ, der einem gleich auffallen würde, und auch niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Das Gesicht eines Soldaten eben.
Unterhalb der vom Rasieren geröteten Haut des Halses die grüne Uniform mit tadellosem Sitz. Die roten Quasten ragen leuchtend über die Schultern hinaus, wie Beeren aus sonnenbeschienenem Gras. Er hält die Mütze fest umklammert in den Händen, steht mit leicht gebeugten Knien und etwa schulterbreit auseinandergestellten Füßen da. Die schwarzen Stiefel blank poliert, so dass sich das Deckenlicht darin spiegelt.
Stundenlang kann er abends in dieser Haltung verharren. Er starrt sein Spiegelbild so lange an, bis es sich auflöst, verformt, die Züge eines Fremden annimmt. Bis er sich von dem Mann, der ihn ansieht, auf seltsame Weise tatsächlich bedroht fühlt. Verängstigt von der Erscheinung, die er sieht, von ihrer Übermacht, aber gleichzeitig auch in ihren Bann gezogen. Andere Male wiederum empfindet er Abscheu.
Oft sind die Gefühle Schwankungen unterworfen, und dieses Wechselspiel der Empfindungen, die innere Zerrissenheit, ruft mitunter einen unergründlichen Teil seines Wesens wach. Er verliert sich in diesem Bild, das ihn gefangen hält. Gefesselt vom Antlitz seiner Seele, das ihm flüchtig zuzwinkert.
Aber heute Abend wird es spät werden. Er hat noch etwas zu erledigen.
Der General nickt sich zu – wegtreten –, geht aus dem Bad und durch das stille Haus in sein Büro. Es ist ein kleiner Raum. Auf einer Seite befindet sich das schreckliche, unfertige Ding, das ihn anwidert und gleichermaßen fasziniert, dem er jetzt aber keine Beachtung schenkt. Stattdessen geht er zur gegenüberliegenden Seite, auf der sich sein Schreibtisch und der Computer befinden.
Er hat etwas zu erledigen: immer mehr Arbeit. Trotz des arbeitsreichen Tages, der hinter ihm liegt, kostet er den Aufschrei aus, den seine Taten ausgelöst haben, und berauscht sich daran, dass sein Plan – endlich – allmählich Gestalt annimmt. Bis jetzt läuft alles wie erwartet. Warum auch nicht? Er ist immer vorsichtig. Der Erfolg steht ihm zu. Er ist Soldat.
Der General streift Handschuhe über und zieht das Dokument, das er vor Tagen getippt und ausgedruckt hat, aus der verschlossenen Schreibtischschublade. Dann legt er es auf den Computertisch neben dem Monitor und liest die ersten paar Zeilen, auch wenn er sie bereits auswendig kennt.
Sehr geehrter Detective,
ich weiß noch nicht, wer Sie sind. Und zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Schreiben verfasse, wissen auch Sie nicht, wer ich bin. Sie wissen nichts von meiner Existenz und haben nicht die leiseste Ahnung, was ich vorhabe. Um ehrlich zu sein, weiß ich selbst auch noch nicht, wann es losgehen wird. Und deshalb wird es funktionieren. Deshalb werden Sie mich nie kriegen.
Und so weiter.
Alles ist wahr. Es ist sogar sehr schön.
Auf dem Boden neben dem Schreibtisch liegt die aktuelle Abendzeitung. Er nimmt sie auf und überfliegt die Meldung über den ersten Mord, bis er die Stelle findet, die er eigentlich sucht. Da steht es. Der Mann, der es nicht schaffen wird, seinen Code zu knacken. Sein Gegenspieler, wie die Gestalt im Spiegel. Der General nimmt den blauen Füllfederhalter zur Hand und ergänzt den ausgedruckten Brief.
Sehr geehrter Detective Hicks.
6
D u stehst heute in der Zeitung«, rief Rachel herüber.
»Ach ja? Verdammt.«
»Liegt da drüben auf dem Tisch.«
»Danke.«
Sie war in der Küche und bereitete das Abendessen zu. Ich hörte sie mit den Töpfen klappern, ab und zu ein leises Stöhnen, wenn erneut ein Ziehen sie durchwallte. Dennoch wusste ich, dass ich gut beraten war, ihr meine Hilfe lieber nicht anzubieten. In dieser späten Phase der Schwangerschaft neigte ich dazu, zu viel Aufhebens um alles zu machen, ihr möglichst schnell alles aus der Hand zu nehmen, und das ärgerte sie über die Maßen. Ich bin nicht krank, sagte sie immer. Und Hilfe werde ich noch früh genug brauchen. Trotzdem ließ ich nichts unversucht. Das war das Mindeste, was ich tun
Weitere Kostenlose Bücher