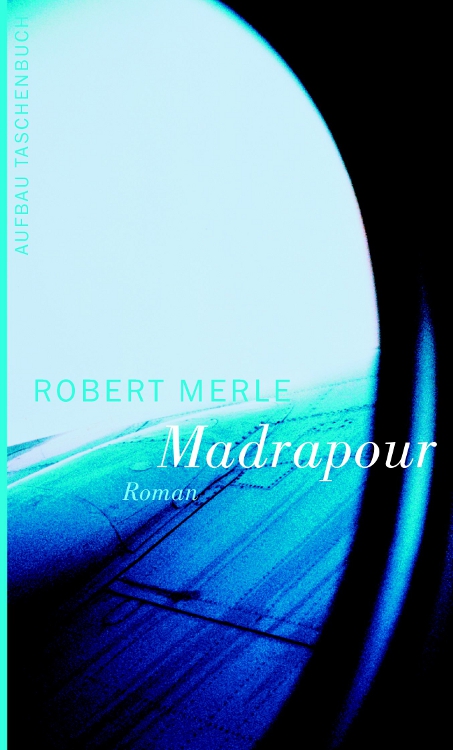![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
hat. Blavatski setzt sich wortlos wieder hin, und eine Sekunde später folgt Chrestopoulos, rot, schwitzend und einen starken Geruch verbreitend, seinem Beispiel.
So peinlich dieser Zusammenstoß gewesen ist, sosehr er uns alle beschämt hat, die einsetzende Stille ist tausendmal schlimmer. Denn wieder hört man das Rasseln, das Pfeifen und Stöhnen, das von Bouchoix ausgeht. Der Lärm der Auseinandersetzung hatte es übertönt, inmitten unseres Schweigens klingt es noch schrecklicher als zuvor.
Das Entsetzliche an dieser Agonie ist, daß man sich mit ihr identifiziert, ich vor allem, da ich mich von Stunde zu Stunde schwächer fühle. Aber ich glaube, daß diese Identifikation in Abstufungen bei allen erfolgt, vielleicht mit Ausnahme von Mrs. Boyd, die mit geschlossenen Augen ihre Krokodilledertasche wie einen Schutzschild an sich preßt, der sie vor dem Tode bewahren soll. Mrs. Banister weiß sich, auch ohne die Lider zu senken, den Anblick des Sterbenden zu ersparen, indem sie ihren Kopf beständig Manzoni zuwendet.
Es versteht sich, daß sie sich auch ihre eigene Bestürzung zunutze macht, um ihr Anliegen voranzutreiben. Sie hat ihre Hand mit so dankbarer Miene Manzoni überlassen, als fühlte sie sich dadurch viel jünger und geschützter. Aber ihre Angst ist trotzdem zu erkennen, an ihrer Blässe und am Zittern ihrer Lippen. Michou bekommt die Grausamkeit der Situation doppelt zu spüren; zum einen hat sie die Ängste der zum Tode Verurteilten selbst durchlebt, zum andern fehlt ihr in dem Augenblick, wo sie ihn am meisten braucht, Pacauds Beistand.
Ihr glatzköpfiger Engel steht ihr nicht mehr zu Diensten. Er kehrt ihr den Rücken zu. Über seinen Schwager gebeugt, wischt er ihm ununterbrochen mit seinem Taschentuch Stirn und Lippen ab, während Bouchoix immerfort den Kopf auf der Sessellehne hin und her wendet und seine Lippen diesen entsetzlichen saugenden Laut ausstoßen, daß man meint, die Luft, die er gerade einatmet, werde die letzte sein.
Mrs. Boyd öffnet mit energischem Griff ihre Krokodilledertasche und holt eine kleine Plastschachtel daraus hervor, die sie Mrs. Banister anbietet.
»Was ist das?«
»Bällchen für die Ohren«, antwortet Mrs. Boyd.
Mrs. Banister zögert, doch offenbar fürchtet sie, sich häßlicher zu machen oder in Manzonis Augen lächerlich zu erscheinen, denn sie sagt leise: »Nein danke, ich bin das nicht gewöhnt.«
»Wie Sie wollen«, antwortet Mrs. Boyd frostig, sichtlich sehr gekränkt, weil man ihre Großzügigkeit zurückweist.
Sie nimmt zwei Bällchen aus der Schachtel, löst sie methodisch aus der Watteverpackung, preßt sie in eine längliche Form und stopft sie sich in die Ohren. Dann verschränkt sie ihre kurzen Arme über ihrer Tasche und schließt die Augen.
Ich selbst begnüge mich, die Augen abzuwenden und auf ein Kabinenfenster zu richten. Auch ich kann Bouchoix’ Anblick nicht mehr ertragen. Ich sehe mich zu leicht an seiner Stelle. Um genau zu sein: nicht die Anzeichen des Todes, der starre Blick, die eingefallenen Augen, die Leichenblässe sind für mich unerträglich, sondern was an Leben in ihm verblieben ist, an Abklatsch des Lebens: das krampfartige Zucken der Hände, die schaukelnden Bewegungen des Kopfes. Ich sehe sie sogar mit abgewendeten Augen. Und ich wiederhole mir endlos dieselbe Frage: Warum, Herr, warum muß man geboren werden, um so zu enden?
Durch das Kabinenfenster betrachte ich das Meer dichter, flockiger weißer Wolken – keine Lücke, durch die man den BODEN erkennen könnte, jenen BODEN, wo unsere Beherrscher sich aufhalten, die unumschränkt über uns gebieten. Diese Wolken sind von überwältigender Schönheit: die untergehende Sonne tönt sie mit einem Rosa, das mir auf unerklärliche Weise ein beglückendes Gefühl des Vertrauens eingibt. Aber hier und da sind in dem Gewoge auch zart malvenfarbene Flächen eingestreut. Und andere, wo die Wolken wie der weiße Flaum eines jungen Vogels ausgefasert sind. Abermals fühle ich in mir den wahnsinnigen Drang auf steigen, das Flugzeug zu verlassen und in diesen Wolken zu baden, in ihnen und auf ihnen zu schwimmen wie in den lauen Wassern des Mittelmeers. Aber natürlich darf man diesem Meer mit seinen zarten Farbtönen nicht trauen. Jenseits des Kabinenfensters ist einem der Tod genauso sicher wie diesseits.
Ich weiß es genau, aber das hindert mich nicht, mir sehnlichst zu wünschen, die Chartermaschine zu verlassen, so wie der Inder sich »vom
Rad der Zeit
losreißen« wollte.
Weitere Kostenlose Bücher