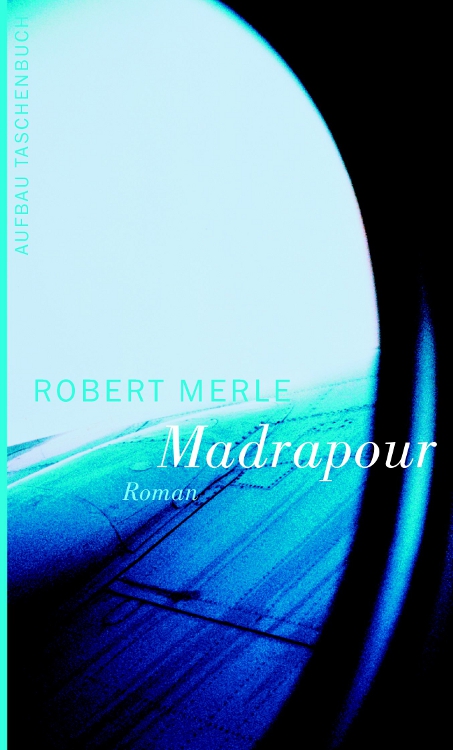![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
es den Anschein.
Schweigen. Da taucht Chrestopoulos auf, voran die gelben Schuhe und im Gefolge die Wolke billigen Parfums, und nimmt wieder seinen Platz zwischen dem Inder und Pacaud ein. Er war so lange weg, daß man sich fragen kann, ob er nicht hinter dem Vorhang der Touristenklasse gestanden und den ganzen Wortwechsel zwischen Blavatski und Caramans oder einen Teil davon belauscht hat.
An Bord dieser Maschine überrascht mich nichts mehr. Hat nicht Blavatski indirekt eingestanden, daß auch er, vielleicht auf dieselbe Weise, vielleicht mit einem raffinierten Gerät, mit angehört hat, wie Chrestopoulos wenige Minuten zuvor Caramans vor ihm warnte?
Die Stewardess kommt aus der Bordküche zurück und setzt sich am äußersten Ende des linken Halbkreises auf ihren Platz. Sie hält die Hände über den Knien gekreuzt und verharrt regungslos mit abwesendem Blick. Mir kommt ein seltsamer Gedanke. Ich habe den Eindruck – aber vielleicht hat man meinen Hang zum Mystizismus schon bemerkt –, daß eine Offenbarung von erheblicher Tragweite die Stewardess bedrückt: zum Beispiel das Verschwinden Gottes.
Ich weiß, was man mir entgegenhalten wird: daß es ebenso schwierig ist, Gott zu verlieren, wenn man ihn hat, wie ihn zu finden, wenn man ihn nicht hat. Durchaus einverstanden.
Darf ich jedoch an dieser Stelle von den Vorkehrungen sprechen, die ich treffe, um ihn mir zu bewahren? Da der Glaube ein Akt des Vertrauens ist, halte ich dafür, daß man blind vertrauen sollte. Eine himmlische List, wie jeder errät. Denn sobald der Zweifel auftaucht, ist er
a priori
verdächtig. Außerdem ist er unbequem und »macht sich nicht bezahlt«, wie die Engländer sagen. Ohne etwas zu gewinnen, verliere ich durch ihn alles – zumindest alles das, woran mir liegt: ein väterlicher Gott, ein Universum, das einen Sinn hat, und ein tröstliches Jenseits.
Eine Bemerkung noch zu diesem Thema: ohne mich als Beispiel hinzustellen, möchte ich sagen, wie ich mir meinen Frieden bewahre. Ich habe meinen Verstand in Schubladen verteilt, und in das kleinste, unzugänglichste, dunkelste Fach habe ich meine Zweifel eingeschlossen. Sobald einer wagt, den Kopf zu heben, stoße ich ihn mitleidlos ins Dunkel zurück.
Im Moment fühle ich beim Anblick der Stewardess, die Anzeichen ihrer Verzweiflung gewahrend, einen leidenschaftlichen Elan in mir. Ich habe Lust, aufzustehen, sie in die Arme zu nehmen, sie zu beschützen.
Ehrlich gesagt: mich selbst erstaunt es am meisten, in meinem Alter und bei meinem Äußeren so jugendlich zu sein. Aber sie fasziniert mich. Und ich sehe sie ohne jede Hemmung an, ich bin geblendet; Begierde, Zärtlichkeit und natürlich auchMitleid ob ihrer tödlichen Angst überwältigen mich. Seit sie ihr Käppi abgenommen hat, trägt sie ihr schönes goldblondes Haar aufgesteckt, was ihren zarten Hals und ihre Züge viel besser zur Geltung bringt. Ihre fast meergrünen Augen kommen mir schöner vor, seit sie traurig sind. Unersättlich sehe ich sie an. Wenn das Auge Besitz ergreifen könnte, wäre sie schon meine Frau. Denn meine Absichten ihr gegenüber sind ehrenhaft, selbst wenn meine Hoffnung, Gehör zu finden, gering ist.
Nach einigen Minuten halte ich es nicht mehr aus. Es drängt mich nach einem Kontakt mit der Stewardess, sei er noch so bedeutungslos.
»Mademoiselle, würden Sie so freundlich sein und mir ein Glas Wasser bringen?«
»Aber gewiß, Mr. Sergius«, sagt sie. (Ich stelle erfreut fest, daß ich hier der einzige bin, den sie beim Namen nennt.)
Sie verschwindet in der Bordküche und kommt mit einem vollen Glas zurück. Sie trägt es auf einem Tablett, was unnötig ist, weil sie das Glas mit der anderen Hand festhält; vermutlich ist es einfach Vorschrift, das Tablett zu benutzen. Aber bei ihr rührt mich sogar diese bedeutungslose Geste.
»Bitte, Mr. Sergius«, sagt sie, und während sie sich, zwischen Blavatski und mir stehend, zu mir beugt, umfängt mich ihr frischer Mädchenduft.
Ich nehme das Glas, und weil sie Anstalten macht, sich abzuwenden, wage ich in meiner panischen Angst, daß sie sich so schnell entfernen könnte, eine unerhörte Vertraulichkeit: ich strecke den Arm aus, ich halte sie an der Hand zurück.
»Warten Sie bitte«, sage ich hastig. »Sie können das Glas gleich wieder mitnehmen.«
Sie lächelt, sie wartet, sie unternimmt nichts, sich zu befreien, und während ich voller Verwirrung trinke, betrachte ich heimlich ihre kleine Hand in meiner behaarten Pranke. Blavatski
Weitere Kostenlose Bücher