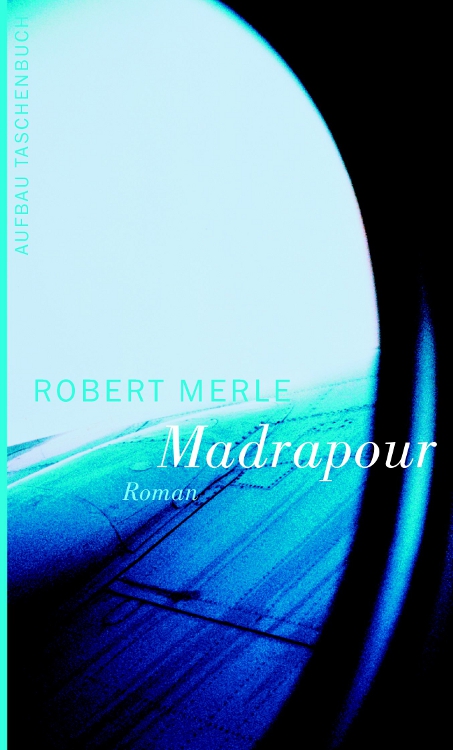![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
Edmonde zu weinen an. Ohne Robbies Arm loszulassen, weint sie still vor sich hin, die Tränen rollen über ihre Wangen und verwischen ihr Make-up.
Pacaud, der in seiner behaarten Pranke eine von Michous Händen hält, sagt mit erstickter Stimme: »Wir sind aber doch nicht im gleichen Sinne krank wie zum Beispiel Monsieur Sergius oder … Sie selbst. Angesichts dessen wäre es beinahe Vergeudung, das Oniril an alle zu verteilen.«
»Es ist keine Vergeudung«, entgegnet Robbie mit unendlich schwacher Stimme, aber mit dem Schatten eines Lächelns auf seinem fahlen Gesicht. »Ich habe nachgerechnet. Die Menge ist so bemessen, daß jeder Passagier für die Dauer von dreizehn Tagen täglich zwei Dragees erhalten kann – wenn jede Nacht ein Passagier das Flugzeug verläßt, was ich für wahrscheinlich halte.«
»Das ist heller Wahnsinn!« schreit Caramans wie von Sinnen. »Nichts, absolut nichts ermächtigt Sie, eine so unsinnige Hypothese aufzustellen! Sie haben dafür nicht die Spur eines Beweises!«
Robbie, der starr in seinem Sessel sitzt, die Hände schlaff auf den Seitenlehnen, sieht Caramans mit seinen hellbraunen Augen durchdringend an, und obwohl sein Blick kein Quentchen Bosheit enthält, bringt dessen Intensität Caramans zum Schweigen.
»Es gibt keinen Beweis, aber Indizien«, sagt Robbie kaumhörbar. »Beweiskräftige Indizien. Zum Beispiel die Anzahl der Dragees. Ob Sie es glauben oder nicht, Monsieur Caramans, man hat sogar berücksichtigt, daß einer der Passagiere seinen Anteil ablehnen wird. Deshalb sind es 180 Dragees und nicht 182, wie bei genauer Rechnung erforderlich wären.«
»Sie phantasieren, Monsieur«, sagt Caramans, nachträglich auffahrend. »Ich glaube Ihnen kein Sterbenswörtchen!«
Wieder breitet sich Schweigen aus, und mit kraftloser Stimme sagt Robbie lächelnd:
»Hören Sie, Monsieur Caramans, warum wollen Sie, der Sie soviel Vernunft besitzen, sich nicht in das Unvermeidliche fügen? Die Dinge sind jetzt völlig klar. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, aus diesem Flugzeug herauszukommen: wie Bouchoix.«
Laut protestierend, daß sie gar nicht krank seien, nehmen bis auf Robbie schließlich alle Passagiere das Oniril. Dieses »Beruhigungsmittel«, meint Caramans, der die Wirkung von vornherein herunterspielt, werde ihm helfen, seine Ungeduld ob der »etwas langen Reise« zu bezähmen. Wie jedermann schluckt er sein Dragee, und um seinen unerschütterlichen Glauben an unser Reiseziel unter Beweis zu stellen, holt er seine Akten aus der Tasche und vertieft sich darin, mit einem goldenen Kugelschreiber Randglossen kritzelnd. Blavatski begnügt sich, eine witzige Bemerkung über die Tatsache zu machen, daß er selbst eine Droge nimmt, während doch der Kampf gegen die Droge seine Aufgabe ist. In meinen Ohren klingt diese Fröhlichkeit unecht. Es ist der Galgenhumor der unerschrockenen amerikanischen Filmhelden, die den Tod vor Augen haben.
Seine gute Laune hat indessen zur Folge, daß die Verteilung des Onirils, die ein makabrer Vorgang hätte sein können, von den Passagieren auf die leichte Schulter genommen wird.
Pacaud geht ebenfalls, und nicht als letzter, auf das Spiel ein. Lachend fragt er die Stewardess, ob sie auch wirklich sicher sei, daß das kleine Dragee keine Aphrodisiaka enthalte. Und Madame Edmonde, die ihre Tränen getrocknet und sich wieder zurechtgemacht hat, läßt sich mit ihm auf ein Geplänkel von zweifelhaftem Geschmack ein.
Zu vornehm, um an solcher Belustigung teilzunehmen, schlucken die
viudas
ihr Oniril mit einer gewissen Resignation,als ob sie sich gnädig zur Erfüllung einer bedeutungslosen Formalität herabließen, der sie sich nicht einmal dank ihrer hohen gesellschaftlichen Stellung entziehen können.
Wenn ich nicht selbst unter der Wirkung des Onirils gestanden und nicht gewußt hätte, daß ich noch vor Abend eine weitere Dosis bekommen würde, wäre mir diese ganze Szene wohl sehr erbärmlich vorgekommen. Vielleicht habe ich sie auf Grund meines Zustandes nicht aufmerksam genug verfolgt, manche Einzelheiten werden mir entgangen sein. Tatsächlich quälte mich die ganze Zeit ein einziger Gedanke: Robbies erstaunliche Weigerung, das Oniril zu nehmen.
Nachdem die Droge hinreichend auf meine Reisegefährten gewirkt hat und nicht mehr zu befürchten ist, daß ich sie beunruhigen könnte, frage ich Robbie nach dem Grund seiner Haltung. Obwohl er so viele Beweise eines festen Charakters geliefert hat, gibt er mir keine eindeutige
Weitere Kostenlose Bücher