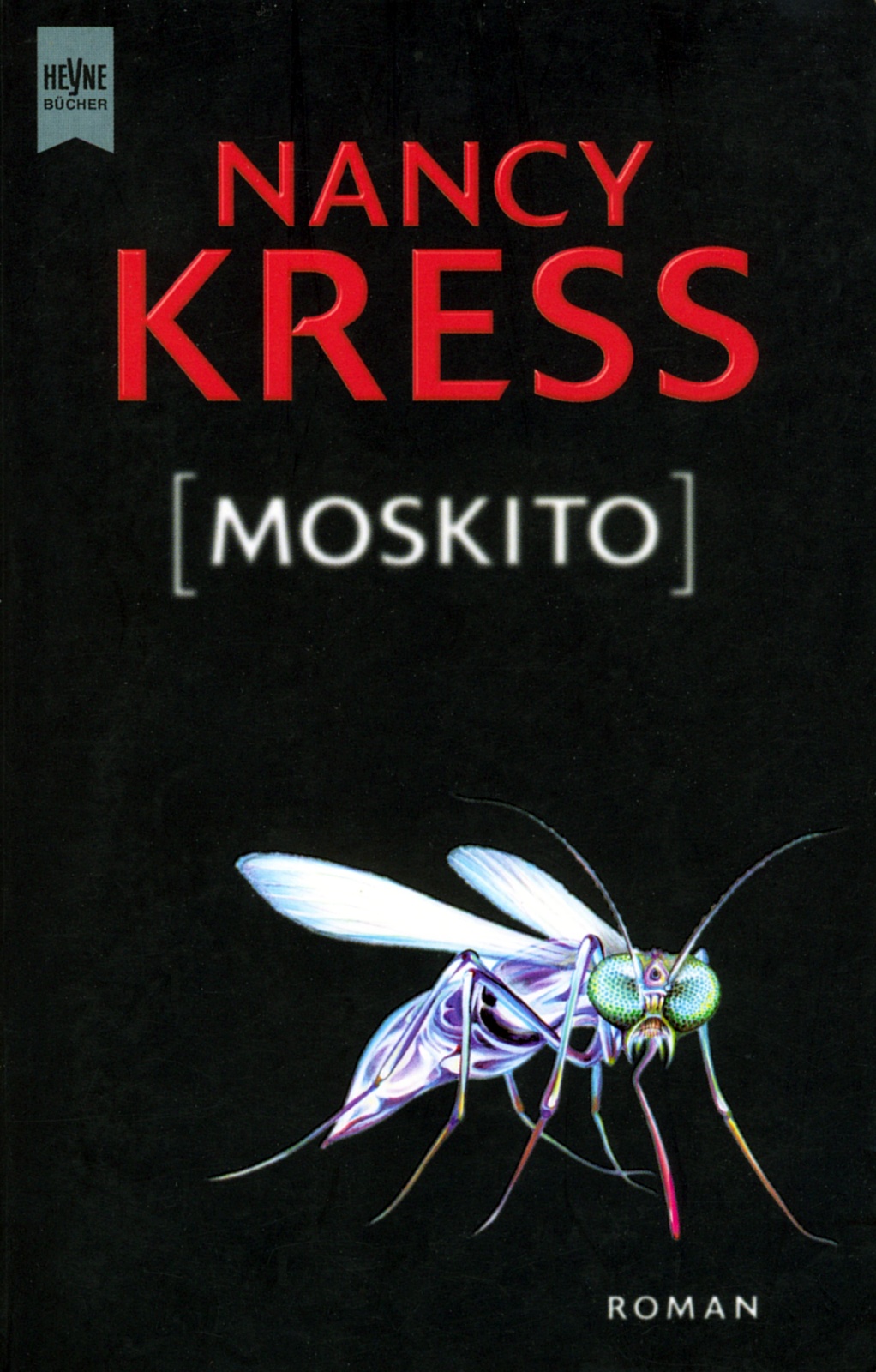![Moskito]()
Moskito
ermutigend; letztes Mal, als sie zusammen mit einem Team des Zentrums hier durchgekommen war, hatte es auf dem Flughafen N’Djili nur Soldaten mit Bajonetten und ruinierte Einrichtungsgegenstände gegeben.
Kinshasa selbst wirkte weniger ermutigend. Nachdem sie den vielen aufgehaltenen Händen in N’Djili fachkundig ausgewichen war, nahm Melanie ein Taxi zum Mama-Yemo-Hospital. Das Taxi kroch langsam und qualvoll über die geborstenen Straßenbeläge und durch die tiefen Schlaglöcher, die randvoll waren mit stinkendem Wasser. Etliche Male mußte der Fahrer eine Umleitung nehmen. Durch die offenen Fenster – das Taxi hatte keine Klimaanlage – musterte Melanie die Landeshauptstadt, die sie bereits viermal zuvor in verschiedenen Stadien des Funktionierens, unter verschiedenen Regimen und in verschiedenen Stufen des Bürgerkrieges gesehen hatte.
Auf dem größten Markt der Stadt drängten sich die Frauen, verkauften Maniok, Bananen und Zuckerrohr. Das Geschäft schien gut zu gehen.
Der Zoo lag immer noch in Schutt und Asche; die Gebäude waren verkohlte Ruinen, die Tiere waren tot.
Das Hotel Intercontinental stand strahlend inmitten seiner Gärten und Springbrunnen, bewacht von Soldaten, eine luxuriöse Zufluchtsstätte für die Reichen. Ein livrierter Diener fuhr Jaguars und Mercedes auf den Parkplatz.
Vor der Lovanium-Universität stiegen die Studenten flott die sauber geweißten Stufen hinauf und hinab.
Scharen von Bettlern belagerten den Rand von La Cite, Kinshasas riesigem Slum. Viele von ihnen sahen krank aus oder mißgestaltet, aber sie bewegten sich nicht alle mit dieser schrecklichen Stumpfheit voran, die aus Elend und Unterernährung entsprang und die Melanie bei ihrem letzten Aufenthalt hier beobachtet hatte.
Und selbst die Bettler trugen Plastiksandalen an den Füßen. Zumeist.
Die Fischer, die am großen Fluß in den Hütten mit den Blechdächern lebten, besaßen jetzt Netze.
Und am besten von allem gefiel Melanie eine Frau in einem bunten Baumwollkleid, die neben ihrer Hütte kniete und das Unkraut zwischen einem Dutzend Maispflanzen ausriß. Wenn Mais in Kinshasa so hoch werden konnte, ohne gestohlen oder niedergetrampelt zu werden, dann hatte der Kongo seit dem letzten Krieg einen weiten Weg zurückgelegt.
Das Mama-Yemo-Hospital jedoch erinnerte Melanie daran, daß der ›weite Weg‹ des Kongo im Vergleich zum Rest der Welt nur in Zentimetern gemessen werden konnte.
Es gab immer noch mehr Patienten als Betten. Die Kranken lagen auf abgeschabten weißen Stahlrohrbetten, auf Wachstuchliegen ohne Laken, auf Strohsäcken, auf dem Fußboden. Bei einigen von ihnen konnte Melanie die Diagnose auf den ersten Blick stellen: das hier ist Malaria, das dort Unterernährung, das ist Gangrän, das dort drüben Ruhr. Sie packte ihre beiden Taschen und ging festen Schrittes weiter. Die einzigen Medikamente, die sie mithatte, waren solche, deren Mitführung zu seinem persönlichen Gebrauch von jedem vernunftbegabten Amerikaner erwartet werden konnte: ein paar Antibiotika, ein Erste-Hilfe-Kästchen, Mefloquin zur Malariaprophylaxe und -behandlung und Lomotil gegen Durchfall, den sie inständig hoffte, nicht zu bekommen, weil Lomotil sich nicht mit Mefloquin vertrug.
»M’sieu le docteur Ekombe Kifoto!« rief sie laut. Niemand schenkte ihr auch nur die geringste Aufmerksamkeit.
Sie war nicht hier als Repräsentantin des Zentrums für Seuchenkontrolle, ja nicht einmal als private Ärztin, denn davon hätte sie ein halbes Dutzend Stellen innerhalb und außerhalb des Kongo in Kenntnis setzen müssen; sie war hier als anonyme Touristin, und so konnte sie den leidenden Menschen nicht helfen, die eingekeilt in den stinkenden Korridoren lagen. Sie marschierte entschlossen weiter.
»M’sieu le docteur Ekombe Kifoto?«
Schließlich führte eine kongolesische Krankenschwester sie in jene Abteilung, wo Kifoto den Malariapatienten Chloroquin verabreichte. In dem Moment, als er Melanie erblickte, eilte er auf sie zu. »Melanie! Vous ätes ici!«
»Aber was ist ›hier‹?« fragte sie auf Französisch. »Die Hölle?« Ein alter Scherz aus einer vorhergegangenen Epidemie, einem gemeinschaftlichen Einsatz der WHO, des Gesundheitsministeriums von Zaire und des Zentrums für Seuchenkontrolle. Wenn es um eine Epidemie ging, konnte kaum jemand Ekombe Kifoto das Wasser reichen.
Er führte Melanie in einen winzigen leeren Pausenraum, in dem sich Stühle und ein kleiner Kühlschrank befanden, aber kein Tisch. Sie tranken
Weitere Kostenlose Bücher