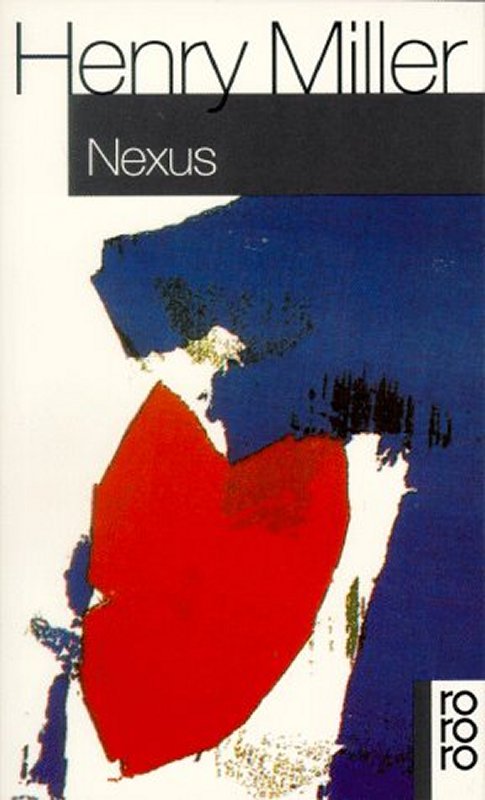![Nexus]()
Nexus
sehen würde. Ich liebte sie, nicht weil sie fremd und entlegen war, denn sie war mir in Wirklichkeit näher als die Kunst des Westens, ich bewunderte sie wegen der Liebe, aus der sie entstanden war, einer Liebe, die von der Menge geteilt wurde und die nie zum Ausdruck gekommen wäre, wenn sie nicht von, durch und für die Menge gewesen wäre. Ich liebte die Anonymität ihrer erstaunlichen Schöpfungen. Wie tröstend und stärkend, nur ein niedriger, unbekannter Arbeiter zu sein - ein Handwerker und kein Genie! -, einer unter Tausenden, der das schuf, was allen gehörte. Nicht mehr zu sein als ein Wasserträger - das bedeutete mir mehr, als ein Picasso, ein Rodin, ein Michelangelo oder ein da Vinci zu werden. Wenn ich das Panorama der europäischen Kunst überschaue, sehe ich immer, wie der Name des Künstlers heraussticht wie ein wunder Daumen. Und mit dem großen Namen verbindet sich auch gewöhnlich eine Geschichte des Leides, des Elends und grausamen Mißverstehens. Bei uns im Okzident hat das Wort Genie etwas Monströses an sich. Ein Genie ist, wer sich nicht anpaßt; ein Genie , wer Prügel bekommt; ein Genie , wer verfolgt und gequält wird; ein Genie , wer im Rinnstein, im Exil oder auf dem Scheiterhaufen endet.
Ich machte allerdings meine Busenfreunde oft wütend, wenn ich die Vorzüge anderer Völker rühmte. Sie behaupteten, ich verfolge damit eine Absicht, ich täte nur so, als ob ich die Werke fremder Künstler schätzte und achtete, um unser eigenes Volk, unsere eigenen Künstler herunterzusetzen. Sie ließen sich nie überzeugen, daß mir das Fremde, das Exotische oder das Ausländische in der Kunst unmittelbar einging, daß ich dazu keine Vorbereitung, keine Einführung, keine Kenntnis ihrer Geschichte oder ihrer Entwicklung benötigte. «Was soll das bedeuten? Was wollen Sie damit sagen?» riefen sie spöttisch. Als wenn Erklärungen etwas bedeuteten, als wenn ich mich darum kümmerte, was «sie» sagen wollten.
Vor allem aber war es die Verlorenheit und Zwecklosigkeit des Künstlerseins, die mir am meisten zu schaffen machten. In meinem Leben war ich bis jetzt nur zwei Schriftstellern begegnet, die ich Künstler nennen konnte: John Cowper Powys und Frank Harris. Den ersteren lernte ich durch seine Vorlesungen kennen, den letzteren in meiner Rolle als Schneiderlehrling, der ihm die Anzüge ablieferte und ihm in die Hosen half. Lag die Schuld vielleicht an mir, daß ich außerhalb des Kreises geblieben war? Wie sollte ich einen anderen Schriftsteller oder einen Maler oder einen Bildhauer kennenlernen? Sollte ich mich in sein Arbeitszimmer oder Atelier drängen und ihm sagen, auch ich möchte gern schreiben, malen und bildhauern, tanzen und wer weiß was noch? Wo kamen Künstler in unserer Riesenstadt zusammen? In Greenwich Village, sagt man. Ich hatte im Village gewohnt, zu allen Stunden auf seinen Straßen flaniert, seine Cafes und Teehäuser besucht, seine Galerien und Ateliers, die Buchläden, die Wirtschaften, Lasterhöhlen und Kellerkneipen. Ja, ich habe in irgendeinem dunklen Lokal Ellbogen an Ellbogen mit Maxwell Bodenheim, Sadakichi Hartmann und Guido Bruno gesessen, aber ich war dort nie einem Dos Passos, einem Sherwood Anderson, einem Waldo Frank, einem E. E. Cummings, einem Theodore Dreiser oder einem Ben Hecht begegnet. Nicht einmal dem Geist eines O'Henry. Wo steckten diese? Einige waren bereits im Ausland und führten das glückliche Leben der Verbannten oder Renegaten. Sie waren nicht auf der Suche nach anderen Künstlern, besonders nicht nach so blutigen Anfängern, wie ich einer war. Wie wunderbar wäre es damals gewesen, als es soviel für mich bedeutet hätte, wenn ich mit Männern wie Theodore Dreiser oder Sherwood Anderson, die ich anbetete, hätte sprechen können! Vielleicht hätten wir uns etwas zu sagen gehabt, mochte ich auch ein unbedeutender Anfänger sein. Vielleicht hätte ich dann den Mut gefunden, früher anzufangen — oder davonzulaufen, Abenteuer in fernen Ländern zu suchen.
War es Scheu, Schüchternheit, mangelndes Selbstvertrauen, die mich während jener unfruchtbaren Jahre dazu verurteilten, das Leben eines einsamen Sonderlings zu führen? Mir fällt da ein fast lächerlicher Zwischenfall ein. Zu der Zeit, als ich mit O'Mara umherkreuzte, verzweifelt nach etwas Neuem und Erregendem suchte - und mochte es nur ein Jux sein -, gingen wir eines Abends zu einem Vortrag in der Rand-School. Es war einer jener literarischen Abende, wo die Zuhörer aufgefordert wurden,
Weitere Kostenlose Bücher