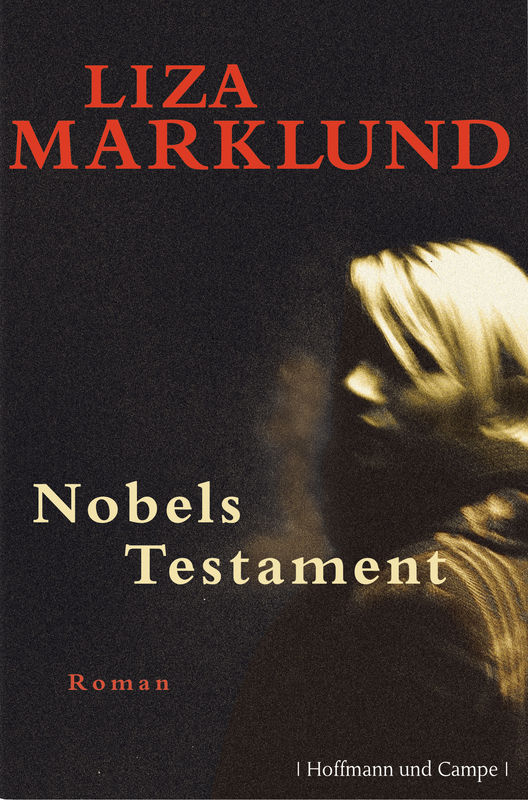![Nobels Testament]()
Nobels Testament
drehte sich um und sah, wie drei in Anzug gekleidete Männer um die Ecke kamen und sich in den engen Gang pressten. Sie waren vollauf mit sich beschäftigt und unterhielten sich laut auf Englisch. Der Mann in der Mitte kam Annika bekannt vor, sie wusste aber nicht, woher.
»Warte hier«, sagte Ebba und verschwand in einem kleinen Raum.
Eine halbe Minute später war sie zurück, ohne Paket.
»Unsere Professorin hat noch nicht bemerkt, dass wir einen Hausmeister haben«, sagte sie.
Annika sah dem lauten Männertrupp nach.
»Was waren das für Kerle?«
Sie deutete auf die Tür, durch die sie verschwunden waren.
»Bernhard Thorell und seine Hurra-Gehilfen«, sagte Ebba. »Die springen schon die ganze Woche hier herum. Da ist mein Büro.«
Mit einem vierstelligen Code öffnete sie die Tür und bat Annika in das kleinste Büro, das sie je gesehen hatte. Drei Schreibtische mit Computern und Akten waren hier auf sieben fensterlose Quadratmeter gequetscht.
»Und ich dachte, bei mir wäre es eng«, sagte Annika.
Bernhard Thorell, dachte sie. Der Pharma-Geschäftsmann aus den USA, der vergangenen Winter an der Pressekonferenz im Nobel-Forum teilgenommen hatte.
»Früher war das hier der Raucherraum«, sagte Ebba. »Wir haben deshalb eine sehr gute Lüftung. Willst du mein Labor sehen?«
»Hast du ein eigenes?«, fragte Annika, deren Vorstellung von der Welt der Forscher langsam korrigiert wurde.
»Zusammen mit sieben anderen. Nach links und dann gleich wieder den ersten Gang links.«
Annika ließ Ebba vorangehen und folgte ihr mit einem latenten Gefühl von Klaustrophobie. Von allen Seiten kam der Korridor auf sie zu, von oben und unten und von den Seiten. Zwar war es hier ein wenig heller, alle Labortüren hatten runde Fenster, aber die Empfindung, eingesperrt zu sein, war noch schlimmer. Vielleicht lag es an den Bücherregalen, Computern und Druckern, die sich in einer Reihe mit Zellnährlösung, Reagenzgläsern und Kulturplatten zwischen den kleinen Laborräumen drängten – das alles umgeben von Zetteln und Anschlägen, die rundherum aufgehängt waren. An manchen Labortüren hingen Belegpläne mit Namen, Tagen und Uhrzeiten.
»Das hier ist eine Schleuse«, sagte Ebba. »Du musst die Schuhe wechseln und Schutzkleidung anziehen, um ein Zell-Labor betreten zu dürfen. Hier, man knöpft das einfach im Nacken zu.«
Annika nahm einen gelb-weiß gestreiften Kittel entgegen, der sie an die Chirurgenkleidung aus
Emergency Room
erinnerte. Die Ärmel waren lang, und die Bündchen umschlossen die Handgelenke eng. In einem Regal, rechts neben einigen Gasflaschen, standen zahlreiche weiße Clogs.
»Welche soll ich nehmen?«, fragte Annika und las die Namen, die darüberstanden.
»Ist egal«, sagte Ebba.
Sie betraten das Labor.
Eine asiatische Frau saß hochkonzentriert unter einer Art Dunstabzugshaube und träufelte etwas mit einer großen Pipette in ein Reagenzglas. Sie trug die gleiche gelb-weiße Schutzkleidung und Handschuhe, die über die Bündchen gingen.
»Es gibt hier haufenweise Chinesen«, sagte Ebba und dann »Hallo« zu der Frau. Die antwortete nicht.
»Was macht sie?«, fragte Annika.
»Weiß ich nicht«, sagte Ebba und schielte kurz zu ihr hinüber.
»Zellen vorbereiten, um mithilfe von Antikörpern Proteine ausfindig zu machen, glaube ich. Sie wirkt so unglaublich angespannt. Antikörper sind teuer, ein großes Experiment kann bis zu sechzigtausend Kronen kosten. Bei uns ist gerade eine ganze Lieferung verschwunden …«
Sie kam ein wenig dichter an Annika heran und senkte die Stimme, obwohl die Chinesin sie offensichtlich nicht verstehen konnte.
»Man fragt nie danach, was andere tun«, sagte sie, »und man spricht auch nicht über die eigenen Projekte. Am schlauesten ist es, die eigene Forschung nicht mit der von anderen zu mischen.«
Ebba trat einen Schritt zurück und redete in normaler Gesprächslautstärke weiter.
»In diesem Inkubator wohnen meine Zellen.«
Sie öffnete etwas, das aussah wie ein gewöhnlicher Kühlschrank, aber drinnen war es nicht kalt, sondern warm.
»Bei siebenunddreißig Grad fühlen sie sich am wohlsten. Und dann noch ein bisschen Zellfutter und fünfprozentiges Kohlendioxid, dann machen sie fast immer, was man will. Das heißt, wenn nichts dazwischenkommt.«
»Was könnte das sein?«, fragte Annika.
»Man braucht nur während eines Experiments die falsche Flasche zu nehmen«, sagte Ebba. »Man könnte sich so unglaublich ungeschickt anstellen und verschiedene
Weitere Kostenlose Bücher