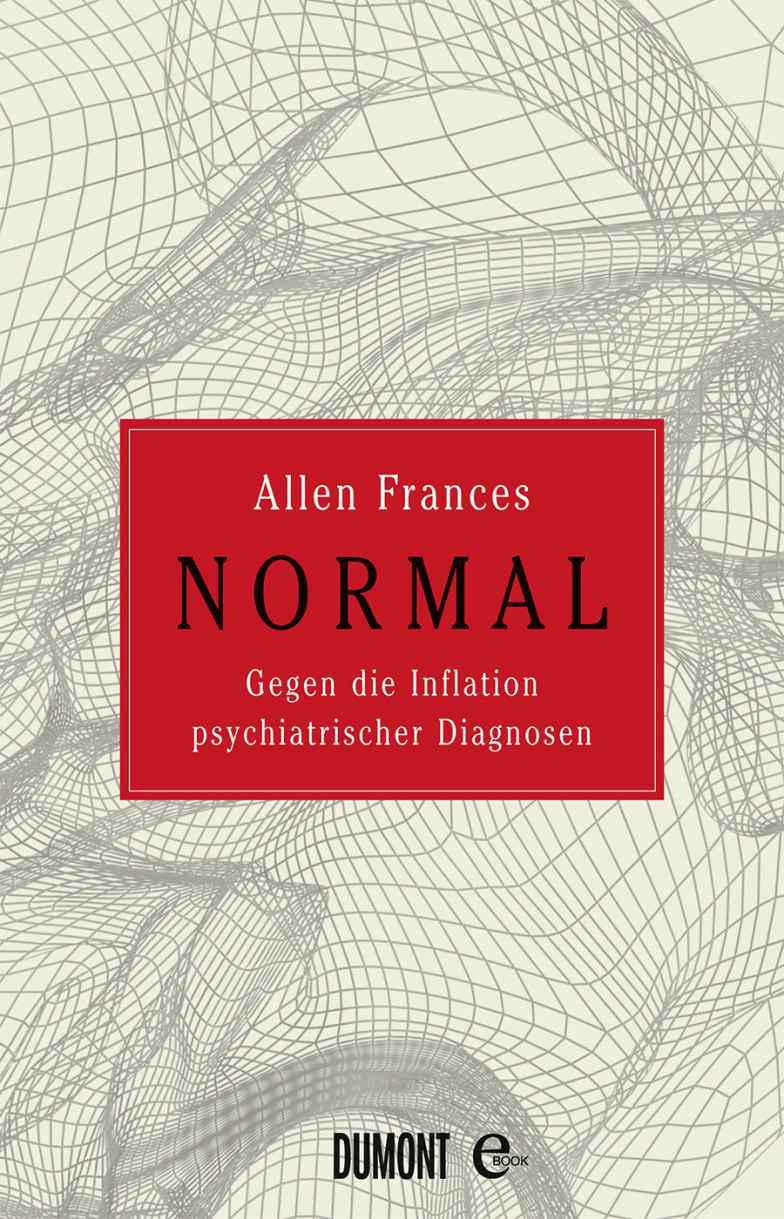![Normal: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen (German Edition)]()
Normal: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen (German Edition)
abwesend, der Vater aus geschäftlichen Gründen, die Mutter aufgrund regelmäßiger Zusammenbrüche. Sein schwieriger Charakter und ihre Instabilität waren eine denkbar schlechte Kombination für eine Ehe. Als Maria acht war, ließen sie sich scheiden und trugen einen erbitterten Sorgerechtskampf aus – den der Vater kurzerhand dadurch entschied, dass er mit Maria ins Ausland ging. Während der nächsten zwanzig Jahre sah sie ihre Mutter nicht mehr. Ein Psychologe, der Maria für einen Sorgerechtsprozess begutachtete, beschrieb sie trotz aller widrigen Umstände als gut angepasst und liebevoll. Der Vater stellte eine Reihe von Kindermädchen ein, »die mich eigentlich aufzogen«.
Als Teenager begann Maria mit Drogen zu experimentieren: zuerst mit Marihuana, dann mit LSD und Amphetaminen. Sie wurde launischer und unberechenbarer, ihre schulischen Leistungen nahmen ab. »Bei den Drogen fand ich ein Gefühl von Heimat und einen Rückzug aus meiner angespannten häuslichen Situation.« Nach der Highschool zog sie aus, suchte sich einen Vollzeitjob und schrieb sich am Community College ein.
»Mit zwanzig bekam ich Schlafstörungen. Es wurde mir alles zu viel. Ich ging zu einer Allgemeinärztin, die nach einem fünfzehnminütigen Gespräch eine Depression diagnostizierte. Die Diagnose bestätigte mir, dass mit mir was nicht stimmte, aber es beruhigte mich, dass ich jetzt einen Namen dafür hatte – irgendwie war alles nicht meine Schuld.« Die Ärztin verschrieb so unbekümmert, wie sie diagnostizierte – sie bestellte Maria zu keinem Folgegespräch in die Praxis, sondern erneuerte einfach immer wieder das Rezept. »Am ersten Tag nahm ich ein halbes Paxil, das sich anfühlte wie Methamphetamin. Im Unterricht konnte ich die Beine nicht stillhalten und hatte den fast unkontrollierbaren Drang, aufzuspringen und so schnell zu rennen, wie ich konnte. Nachts fuhr ich schweißüberströmt aus dem Schlaf und hatte Todesangst. Auf der Suche nach einem ›Beruhigungsmittel‹ als Gegengift probierte ich zum ersten Mal Heroin, das in den Künstler- und Musikerkreisen, in denen ich verkehrte, gang und gäbe war. Aus gelegentlichem Konsum wurde bald tägliche Gewohnheit, und dazu nahm ich sämtliche verschreibungspflichtigen Medikamente, die ich in die Finger bekam: Xanax, Klonopin, Valium, Vicodin und Dilaudid.«
Maria ging zu einem Psychologen, der zu diagnostischen Zwecken eine Reihe von Tests mit ihr machte und zu dem Schluss kam, sie leide »unter ›chronischer Depression‹ und ›generalisierter Angststörung‹. Auch das war eine große Bestätigung. Es war nicht meine Schuld, dass ich so verkorkst war! Inwieweit mein Drogenkonsum oder auch die ungelösten (und sehr realen) Probleme meines Lebens mein Testergebnis beeinflusst haben könnten, hinterfragte ich nicht.« Sie wurde zu einem Psychopharmakologen überwiesen. »Unsere Gespräche dauerten ungefähr zehn Minuten. Er verschrieb mir immer mehr Medikamente. Als Drogenkonsumentin fand ich es super, dass ich einen Stoff, den ich zur Entspannung genommen hatte, jetzt auf Rezept bekam. Aber mit meinem Leben ging es bergab.«
Nur kam niemand auf die Idee, dass Marias Drogenkonsum das Grundproblem war, und niemand unternahm den Versuch, ihr herauszuhelfen. Stattdessen wurden der ohnehin sehr fragwürdigen Mischung immer neue Diagnosen und neue Tabletten hinzugefügt. Wenn sie auf ein Medikament nicht wie erwartet ansprach, wurde die Diagnose geändert und ein neues Medikament ausprobiert. Bald war sie bei einer bipolaren Störung angelangt und erhielt noch mehr Medikamente. »Ich nahm eine Mischung aus mehreren legalen und illegalen Drogen und wurde allmählich wirklich sehr depressiv. Morgens kam ich nicht aus dem Bett, ich hörte mit dem College auf, und zum ersten Mal seit meinem vierzehnten Lebensjahr war ich ohne Job. Ich ging nicht mehr ans Telefon, lebte im Halbdunkel, und aus dem Haus ging ich nur, um Drogen zu beschaffen; ansonsten saß ich vor der Glotze. Ich war total süchtig. Ich manipulierte den Psychopharmakologen, um Medikamente zu bekommen, vor allem Klonopin, das eine angenehme, unmittelbar entspannende Wirkung hatte. Wenn ich erwähnte, ich könne nicht schlafen, brachte ich ihn immer dazu, dass er mir weitere ›Spaßdrogen‹ verschrieb.«
Wer braucht einen Drogendealer, wenn man einen übereifrigen Arzt hat, der ein noch besserer Dealer ist? Maria war süchtig: »Ich dachte, wenn es mir mit Medikamenten derart schlecht geht, wie wird’s mir dann
Weitere Kostenlose Bücher