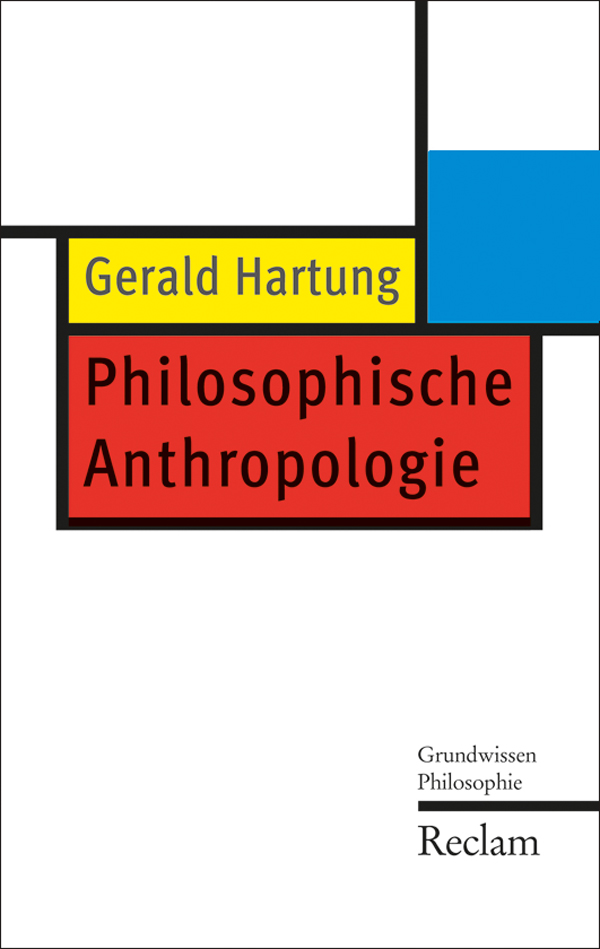![Philosophische Anthropologie]()
Philosophische Anthropologie
der Wille des Lebens ist.« (Nietzsche 1988, 585 f.)
Für das anthropologische Denken ist die Arbeitshypothese Darwins in ihrer Wirkung kaum zu überschätzen. Wird nämlich der Mensch wie jeder andere Organismus beschrieben und werden seine Fähigkeiten allein in diesem Kontext als Ausdrucksleistungen organischer Bedingtheit erfasst, dann tritt eine Ambivalenz menschlicher Selbstbestimmung in die Welt: Der Mensch begreift sich selbst als Teil eines allgemeinen Naturgeschehens und kommt doch zugleich mit dieser reduzierten Selbstbeschreibung nicht klar. In den Worten Nietzsches heißt das: »[…] der Mensch ist, relativ genommen, das mißratenste Tier, das krankhafteste, das von seinen Instinkten am gefährlichsten abgeirrte – freilich, mit alledem auch das interessanteste!« (Nietzsche 1968, 178) Sich selbst bloß relativ zu nehmen und zugleich an seiner Selbstbestimmung zu arbeiten, das ist ein riskantes Unternehmen.
Nietzsche spielt denn auch die naturgeschichtliche Perspektive gegen die philosophische Tradition aus. Aus Sicht einer Geschichte des organischen Lebens ist der Mensch ein Seitenweg, und es gibt keinen Beleg dafür, dass die Entwicklung [56] des Lebens auf unserem Planeten auf ihn als Zielpunkt hinausgelaufen ist. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Mensch im Versuch, sich selbst zu verstehen und sein Leben zu bewältigen, auf sich zurückgeworfen ist. Nirgends außerhalb von sich findet er einen Anhaltspunkt für sein Selbstverständnis, so bleibt er für sich selbst das »interessanteste Tier«.
Auch Wilhelm Dilthey (1833–1911) erkennt die Wirkkraft der darwinschen Lehre an. In einem Brief an den Grafen York von Wartenburg aus dem Jahre 1888 schreibt er: »Lieber Freund, die naturalistische Bewegung in der Wissenschaft hat etwas Unaufhaltsames.« (Dilthey 1923, 75) In seinem Hauptwerk
Einleitung in die Geisteswissenschaften
(1883) skizziert Dilthey die Entwicklungsgeschichte wissenschaftlichen Denkens von der griechischen Metaphysik bis zur modernen Wissenschaft am Leitfaden des menschlichen Selbstverständnisses. Instruktiv ist dabei seine an Jakob Burckhardt orientierte anthropologische These, dass der moderne Mensch erst auf die Bühne der Weltgeschichte trat, als sich für ihn die Einbindung in einen Kosmos natürlicher Zweck- und Ordnungszusammenhänge auflöste. In der Folge der Metaphysikkritik hat der Mensch es nur noch mit sich selbst zu tun. »Es bleibt, wenn das graue Gespinst abstrakter, substantialer Wesenheiten zerrissen ist, hinter ihm übrig – der Mensch, in verschiedenen Lagen einer zum anderen, innerhalb des Mittels der Natur.« (Dilthey 1990, 383)
Der Mensch steht nunmehr vor der Aufgabe, im Akt der Selbstbestimmung den Sinn seines Lebens und einen Sinn von Wirklichkeit zu konstituieren. Wenn also die Rede davon ist, dass letztendlich der Mensch übrig bleibt als Fragender und Befragter, dann heißt das für Dilthey: Jedes Sinnverstehen des Zusammenhangs der geistigen Welt muss mit der Analyse individuellen Lebens einsetzen. »Ehedem suchte man, von der Welt aus Leben zu erfassen. Es gibt aber nur den Weg von der Deutung des Lebens zur Welt. Und das Leben ist nur da in Erleben, Verstehen und geschichtlichem [57] Auffassen. Wir tragen keinen Sinn von der Welt in das Leben. Wir sind der Möglichkeit offen, daß Sinn und Bedeutung erst im Menschen und seiner Geschichte entstehen.« (Dilthey 1927, 364) Bei Dilthey zeigt sich, wie auch bei Eucken und Nietzsche, dass es in der Zurückweisung des Darwinismus darum geht, den Begriff des Lebens und das Phänomen der Lebendigkeit vor den Verengungen eines mechanisch-biologischen Zugriffs zu bewahren.
Ihren Höhepunkt erreicht die Lebensphilosophie mit Henri-Louis Bergson (1859–1941), der mit dem Begriffskonzept des »élan vital« ein Schöpfungsprinzip und eine einheitliche Geschichte des Lebens, unter Einbeziehung ihrer organischen und geistigen Formen, entwirft. Ausgehend vom Phänomen der »Lebendigkeit«, die sich in der Entwicklung aller organischen Formen ausdrückt, kritisiert Bergson den cartesisch-kantischen Dualismus. Seiner Auffassung nach gibt es in der Geschichte des Lebens nur ein Kraftprinzip und verschiedene Ausdrucksgestalten: »In Wirklichkeit gibt es nur einen gewissen Strom von Dasein und seinen Gegenstrom, und aus ihnen die gesamte Entwicklung des Lebens.« (Bergson 1912, 189f.)
Bergsons bekanntestes Buch,
L’évolution créatrice
(1907), ist ein eindringliches Manifest gegen jedweden Versuch
Weitere Kostenlose Bücher