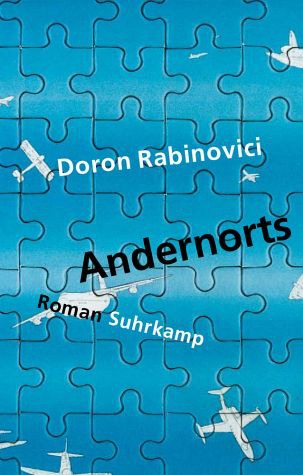![Rabinovici, Doron]()
Rabinovici, Doron
zu haben. »Im Krankenhaus läßt er sich gehen. Zu Hause werden die
Halluzinationen verschwinden. Nicht bei Frida. Die überschwemmt ihn mit ihrer
Fürsorge. Kein Wunder, daß sie ihm eine so hohe Dosis verabreichte, als er
darum bat. Dort wird er zum Pflegefall. Hier ist er auch versorgt, aber bleibt
gefordert. Schlimm genug, daß er zweimal in der Woche zur Dialyse ins Spital
muß. In der Klinik wird er nicht gesund. Er braucht seine gewohnte Umgebung und
seine Familie. Sein Stammlokal. Meine Bridgerunde. Außerdem kann er hier Rudi
kennenlernen.«
Sie sagte: »Wußtest du das
nicht? Rudi zieht bei uns ein, in dein ehemaliges Zimmer. Ist es für dich
schlimm, daß er in deinem Bett schläft? Soll er wieder gehen?« Sie sah ihn
traurig an, die Stirn in Falten, die Wangen eingefallen, als fürchte sie, er
könnte die falsche Antwort geben. Ethan schüttelte den Kopf.
Rudi sagte: »Ich kann, wenn du
willst, auch im Hotel wohnen. Es ist keine Frage des Geldes.«
Rudi konnte nicht sagen,
wonach er in Ethans Hochbett, zwischen den Schallplatten und Büchern des Teenagers
suchte. »Eine Silbe von dir, und ich bin weg«, meinte er. Ethan schüttelte
wieder den Kopf.
Noa sagte: »Bist du
eifersüchtig, weil er in deinem Kinderzimmer schläft? Willst du mit Rudi
tauschen? Du gehst in dein altes Bett, und er soll zu mir unter die Decke? Nur
zu. Sag, was du auf dem Herzen hast, Johann Rossauer.«
Niemand verstand, weshalb er
sich nicht über seinen neuen Bruder freute. Ihm wiederum schmeckte die ganze
Süßlichkeit nicht, sie war ihm zu klebrig und üppig. Am Wochenende lud Dina zum
gemeinsamen Essen. Sie wolle alle Kinder beisammenhaben, Ethan und Rudi, aber
auch Noa.
»Auf die Familie!« Felix stieß
mit ihnen an.
Je nach Thema wurde zwischen
Hebräisch und Deutsch gewechselt. Ein Slalom der Sprachen. Felix begann in
Hebräisch über Osterreich zu sprechen, glitt dann ins Wienerische, um von der
Oper zu schwärmen, und Rudi nahm den Faden auf. Sie fanden schnell zu den
gemeinsamen Vorlieben. Beide nannten ihre Lieblingsarie, und natürlich, ja,
natürlich, hieß es sogleich, war es dieselbe. Felix sagte: »Casta Diva.«
Und Rudi jauchzte: »Die Norma von Bellini! Aber keine kann
es so wie sie, wie die eine.«
»Natürlich. Sie war die Beste
und wird es immer bleiben.« Hier saßen einander zwei Getreue, zwei Jünger gegenüber.
Es war nicht Bosheit, nicht
Widerwillen, sondern eher die Zuneigung für den Vater, die Ethan mitspielen
ließ: »Aber gibt es nicht auch andere Sängerinnen, die zumindest ebensogut
singen? Die Anderson, die Ross, die Gruberovä ... War es nicht einfach ihre
Zeit, ihr Geschick, ihre Präsenz? Ihre Heirat mit Onassis?«
»So ein Blödsinn! Eine
Gemeinheit ist das. Sie war lange vor dieser Ehe die Primadonna, die Diva
assoluta. Sie hat diesen Gesang überhaupt erst erfunden. Sie hat den Weg für
die anderen geöffnet.« Ethan fing Noas Blick auf. Er meinte, eine Mischung aus
Tadel und Mitleid zu erkennen, und unwillkürlich schaute er zu Boden. Niemand
glaubte, es gehe hier nur um Musik.
Rudi lächelte: »Es ist eben
eine Frage des Geschmacks«, aber die Art, wie er das sagte, der Anflug von
Spott in seiner Stimme, widersprach dem, was er sagte.
Nun jagten Felix und Rudi die
Themen durch, hakten ab, was ihnen am wichtigsten war, und siehe da, ob Dirigent
oder Solist, ob Schauspieler oder Regisseur, es fielen dieselben Namen.
Einigkeit auch über jene, die von ihnen verachtet wurden. Als Kinder hatten
beide, Felix und Rudi, Geige gelernt. Beide mochten keine Katzen. Sie sprachen
lange über die Vorzüge verschiedener Hunderassen, über ihre Lieblingsspeisen,
bis Rudi plötzlich erzählte, seine geheime Leidenschaft sei Rhabarber.
»Nein! Rhabarber«, schrie
Dina.
»Rhabarber«, brüllte Felix.
»Ich könnte morden für Rhabarber!«
»Rhabarber«, schüttelte sich
Noa, »schrecklich!«
»Ethan und ich wollten nie
Rhabarber«, sagte Dina, »aber Felix bestand auf Rhabarberkuchen, Rhabarberkompott,
Rhabarberbiskuit. Und vor allem Rhabarbergries.«
»Gries oder Rhabarber«, sagte
Ethan, »ich weiß nicht, was schlimmer ist.«
»Die Leute hassen es, weil es
sie an die Mangelwirtschaft der Nachkriegszeit erinnert«, rief Felix, »aber
ich liebe beides.«
Rudi sekundierte: »Ich auch.«
Und dann: »Ich kann doch nichts dafür. Es ist ja vererbt!«
Rabbi Berkowitsch saß in sich
versunken da. Ein kleiner Mann, dessen Körper filigraner nicht hätte sein
können. Sein schlohweißer Bart
Weitere Kostenlose Bücher