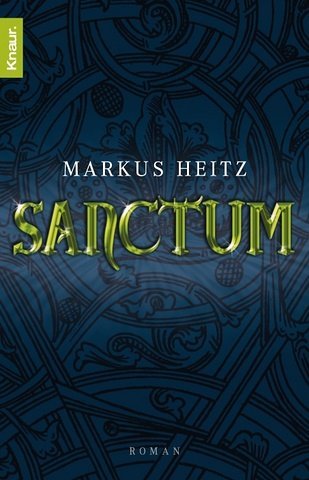![Sanctum]()
Sanctum
zurück und schleppten die vielen Toten außerhalb von Sarais und Jeans Blickfeld. Nach geraumer Zeit hatten sie ihre Arbeit verrichtet, ein Wagen fuhr klappernd davon.
Als sich lange niemand mehr von den Männern gezeigt hatte, wagten Seraph und Jäger, ihr Versteck zu verlassen. Sie liefen durch das Blut, schlichen um die Ecke und trafen auf die Seraphim, die eben über die Straße geeilt kamen.
»Wir wussten nicht, was wir tun sollten, als die zweite Abteilung Männer kam, Sarai«, berichtete Debora niedergeschlagen. »Es waren so viele, und wir …«
»Es war richtig, dass ihr abgewartet habt«, unterbrach Jean sie und fuhr ihr über das schwarze Haar. »Ich bin der Einzige, der einen Fehler begangen hat: Ich hätte den Comte sofort erschießen sollen.« Er zeigte auf die nächste Seitengasse. »Da hinein, bevor die Wache auftaucht. Die Äbtissin wird wissen wollen, wie unsere Mission verlief.«
Schweigend eilten sie durch Rom und strebten ihrem Hauptquartier zu. Zu Hause angekommen, schickte Jean die Seraphim bis auf Sarai ins Bett und begab sich gemeinsam mit ihr zu Gregorias Arbeitszimmer. Er sah unter dem Türspalt, dass noch Licht brannte. Er klopfte und vernahm ihre Aufforderung einzutreten.
»Nicht erschrecken«, warnte er sie vor und drückte die Klinke herab. »Meine Verletzung sieht schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit ist. Nur ein Streifschuss.« Jean trat ein, Sarai folgte ihm.
»Nicht erschrecken ist ein sehr gutes Stichwort«, sagte ein Mann in einem teuren Gehrock, der Gregoria gegenübersaß und eine Tasse Tee in der linken Hand hielt. Er war um die vierzig, hatte halblange dunkelbraune Haare und ein ansprechendes Gesicht, in dem ein prächtiger Schnurrbart prangte. Die Finger der Rechten umschlossen den Griff einer Pistole, die in seinem Schoß lag. Er hob sie an und richtete sie auf die Äbtissin. »Tut mir den Gefallen und verhaltet euch beide ruhig, sonst könnte es geschehen, dass mein Finger sich bewegt und unserer Freundin hier eine Wunde zufügt, die man nicht heilen kann.«
Jean hielt Sarai am Ärmel zurück, die impulsiv einen halben Schritt nach vorn gemacht hatte. »Ich bin nicht in der Stimmung, um Spielchen zu spielen.«
Der Unbekannte nickte. »Ich sehe, dass Ihr einen schweren Tag hattet, Monsieur Chastel. Doch verglichen mit meinen letzten Jahren ist es nichts, und nun setzt euch beide gegen die Tür, damit nicht noch mehr Besucher kommen.«
Sie taten, was er ihnen befohlen hatte. »Was wollt Ihr? Schickt euch Kardinal Rotonda?«
»Ich will nichts von Euch, Monsieur Chastel.« Er schüttelte den Kopf. »Aber ich besuchte eben Signore Ruffo, und da kam mir zu Ohren, dass Ihr mich sucht. Ich dachte mir, dass ich Euch zuvorkomme und vorbeischaue.« Er deutete eine Verbeugung an. »Ich bin Alessio Roscolio.«
XV.
KAPITEL
Italien, Rom, 30. November 2004, 02.33 Uhr
Eric saß im Arbeitszimmer, lehnte sich zurück und schloss die müden Augen. Padre Giacomo Rotonda war also auf irgendeine Weise in Berührung mit der Bestie oder einer Person gekommen, die in ihrer Nähe gewesen war. Die nächsten Schritte lagen daher auf der Hand: Er musste herausfinden, wer hinter Rotonda stand. Und wo er und seine Hintermänner den Welpen versteckt hielten. Und dann …
Ja. Was dann?
Eigentlich hatte Eric die Heilung des Wesens nie ernsthaft in Betracht gezogen, sondern sich immer ein radikales Ende für die Kreatur ausgemalt. Er brauchte ein Wesen, an dem sich die Wut, der Hass, die Schmerzen seiner Familie und seiner Ahnen entladen konnten. Es hätte ein Akt unglaublicher Brutalität sein sollen: Der Welpe sollte langsam qualvoll sterben und dafür büßen, was seiner Familie in den letzten zwei Jahrhunderten angetan worden war.
Doch die letzten Wochen hatten alles verändert. Er fühlte sich unendlich müde, die Jagd versetzte ihn schon lange nicht mehr in einen Rausch, sondern bereitete ihm nur noch Albträume. Außerdem nagte eine tief sitzende Angst an ihm: Drohte er selbst, mehr und mehr zu einem Monstrum zu werden, wenn er nicht einmal mehr davor zurückschreckte, wehrlose Kinder zu töten? So oft er sich auch vor Augen führte, dass es nur darum ging, das Böse zu vernichten, sah er doch immer wieder die Babyleichen im Wald von Plitvice vor sich und schauderte.
Jetzt, da er wusste, dass es einen Orden gab, der sich um die Wandelwesen kümmerte, lockte die Aussicht auf Heilung und ein normales Leben. Ohne die Bestie in sich. Die Schwesternschaft konnte seinen Job gerne
Weitere Kostenlose Bücher