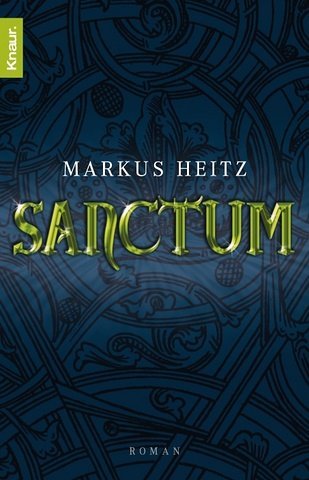![Sanctum]()
Sanctum
wurde verschwörerisch, er sah nach rechts und links, dann beugte er sich nach vorn. »Die Bestie ist nicht tot. Man hat die Menschen getäuscht.«
Gregoria tat so, als sei sie erstaunt. »Monsieur Abbé, wie kommt Ihr darauf?«
»Ich hatte Beweise, dass der Wolf, der von Chastel erschossen worden ist, nichts mit dem Wesen zu tun hat, welches das Gevaudan heimsuchte. Aber«, er warf die Hände in den Himmel, »sie wurden mir genommen.«
»Von wem?«
Acot schöpfte sich erneut Wasser. »Das tut nichts zur Sache. Ein arroganter Adliger, der sich vor dem König fürchtet und das Leben der Menschen aufs Spiel setzt.«
»Und deswegen geht Ihr nach Rom? Ihr bringt Euch in Sicherheit?«
Acot lachte auf. »Nein, Madame Montclair. Ich möchte Fürsprecher finden, am besten den Heiligen Vater selbst, um mir im Gevaudan Gehör zu verschaffen, und mit der Kraft der Heiligen Mutter Kirche die Menschen vor dem vierbeinigen Tod schützen.« Er brach sich ein Stück Brot ab. »Aber bis nach Rom ist es weit und mein Schiff lässt auf sich warten. Ihr seht, ich habe die Stärkung dringend nötig.«
Gregoria betrachtete den jungen Mann. Er war ein Verbündeter im Geiste, jemand mit dem gleichen Ziel, und dennoch war es wohl besser, ihn im Unklaren darüber zu lassen, was sie über die Vorgänge im Gevaudan wusste. Außerdem musste sie sich fragen, ob es gut war, dass zwei Menschen nach Rom reisten und dort mit ihren ähnlichen Anliegen für Aufmerksamkeit sorgen würden. Sie traute Acot zu, dass er den Vatikan in Aufruhr versetzen konnte – doch welche Reaktion würde das beim Legatus provozieren? Sie besaß keine Möglichkeit, seine Reise zu unterbinden, demnach musste sie vor ihm in der Heiligen Stadt ankommen und mit dem Papst sprechen.
Gregoria stand auf. »Ich muss weiter, Monsieur Abbé. Seid versichert, dass ich meinem Mann erzähle, was Ihr berichtet habt. Wir werden unseren Verwandten von Eurer Vermutung schreiben. Euch alles Gute.«
Acot blieb sitzen und schlug das Kreuz. »Ich segne Euch, Madame Montclair. Danke, dass Ihr mich auf dem Pfad der Tugend zurückgeführt und mir zu essen gegeben habt.« Er wollte ihr das Brot zurückreichen, aber sie lehnte ab.
»Behaltet es, Monsieur. Ihr werdet morgen auch wieder Hunger haben.« Sie verließ den kleinen Platz auf einem anderen Weg, als sie gekommen war. Als Gregoria gerade um die Ecke bog, um auf eine der Hauptstraßen zurückzukehren, vernahm sie hinter sich plötzlich laute Männerstimmen. Sie hielt inne. Kam das Geschrei von dem kleinen Platz, den sie gerade erst verlassen hatte?
Der Streit riss abrupt ab, dann hörte sie ein Geräusch, das sie nicht einordnen konnte, und sofort danach das Trappeln von Stiefeln. Drei Männer in langen, leichten Mänteln und mit Tüchern vor den Gesichtern rannten auf sie zu. Der vordere ließ ein blutiges Messer unter seinem Hemd verschwinden.
Gregoria unterdrückte einen Schrei und drückte sich an die Hauswand.
Aber die drei scherten sich nicht um sie, nur der Hintere sah sie kurz an und legte den Zeigefinger gegen die vom Tuch verborgenen Lippen, ehe er weiterhastete.
Als sie verschwunden waren, rannte Gregoria auf den kleinen Platz zurück.
Von Abbé Acot schien jede Spur zu fehlen. An der Stelle aber, wo er vorhin gesessen hatte, befand sich eine Pfütze aus Blut auf dem Kopfsteinpflaster; Spritzer führten zum Brunnen.
Gregoria schluckte, näherte sich dem Brunnenschacht und sah hinab.
Tief unten trieb Acots Leiche im schwarzen Wasser.
»Der Herr stehe seiner Seele bei!«, entfuhr es Gregoria. Sie wich zurück und rannte vom Platz, auf den sich nun bereits die ersten Neugierigen trauten. Sie durfte nicht mit dem Tod des Geistlichen in Verbindung gebracht werden!
In ihrer Unterkunft warf Gregoria die Tür hinter sich ins Schloss und legte den Riegel vor, setzte sich aufs Bett und zog den Rosenkranz heraus, um für Acots Seele zu beten. Sie zweifelte nicht daran, dass der Abbé nicht einfach das Opfer von Räubern geworden war.
III.
KAPITEL
Italien, Rom, Petersplatz
24. November 2004, 22.31 Uhr
Auch wenn es lange nicht so verschneit war wie in Plitvice, die Ewige Stadt empfing Eric mit klirrender Kälte, was für Rom selbst im späten November ungewöhnlich war.
Er trug seinen Einsatzdress: weiße Lederhose, schwarzen Pullover, weißen Lackledermantel, gleichfarbige Stiefel und Handschuhe. Lack hatte einen entscheidenden Nachteil: Er wärmte nicht besonders. Deswegen hielt er sich vornehmlich im Windschatten
Weitere Kostenlose Bücher