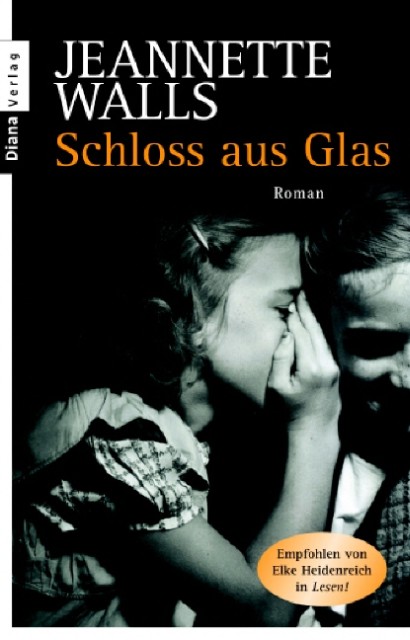![Schloss aus Glas]()
Schloss aus Glas
Angst einzujagen. Er knurrte und zerrte an seinen Hosenbeinen, aber er richtete keinen wirklichen Schaden an. Er war bloß eine arme Töle, die zu viele Tritte abbekommen hatte und sich jetzt darüber
freute, endlich ein Wesen gefunden zu haben, das Angst vor ihm hatte.
Ich hob einen Ast auf und rannte zu den beiden. »Haust du wohl ab!«, schrie ich den Hund an. Als ich meinen Stock hob, winselte er und schlich sich davon.
Die Hundezähne hatten nicht mal die Haut des Jungen verletzt, aber sein Hosenbein war zerrissen, und er zitterte, als hätte er Schüttellähmung. Also bot ich an, ihn nach Hause zu bringen, und trug ihn schließlich huckepack. Er war federleicht. Ich bekam kein Wort aus ihm heraus bis auf spärliche Wegbeschreibungen: »da hoch«, »hier lang«, die er noch dazu so leise hervorbrachte, dass ich sie kaum verstand.
Die Häuser in dem Viertel, in das wir schließlich gelangten, waren alt, aber frisch gestrichen, manche in leuchtenden Farben wie Lavendelblau oder Hellgrün. »Hier ist es«, wisperte der Junge, als wir zu einem Haus mit blauen Fensterläden kamen. Es hatte einen hübschen Garten, war aber so klein wie ein Häuschen für Zwerge. Als ich den Jungen absetzte, stürmte er die Stufen hoch und verschwand durch die Tür. Ich wandte mich zum Gehen.
Auf der Veranda gegenüber stand Dinita Hewitt und betrachtete mich neugierig.
Als ich am nächsten Tag nach dem Mittagessen auf den Schulhof ging, kam die Mädchenbande auf mich zu, aber Dinita blieb im Hintergrund. Ohne ihre Anführerin wussten die anderen nicht, was sie machen sollten, und ließen mich in Ruhe. Eine Woche später bat Dinita mich um Hilfe bei den Hausaufgaben. Sie entschuldigte sich nicht für die Schikanen, erwähnte sie nicht mal, aber sie bedankte sich dafür, dass ich neulich Abend den Jungen aus ihrer Nachbarschaft nach Hause gebracht hatte, und ich dachte mir, dass sie mir damit zeigen wollte, wie Leid es ihr tat. Erma hatte deutlich gemacht, wie sie zu Schwarzen stand, also lud ich Dinita nicht zu uns nach Hause ein, um ihr bei den Hausaufgaben zu hei-
fen, sondern machte den Vorschlag, am nächsten Samstag zu ihr zu kommen.
An dem Tag verließ ich das Haus zur selben Zeit wie Onkel Stanley. Er hatte nie das nötige Kleingeld gehabt, um den Führerschein zu machen, aber jemand aus dem Haushaltswarengeschäft, in dem er arbeitete, holte ihn ab, und er fragte mich, ob sie mich irgendwo absetzen könnten. Als ich sagte, wohin ich wollte, runzelte er die Stirn. »Das ist im Niggerdorf«, sagte er. »Was willst du denn da?«
Stanley wollte nicht, dass sein Kollege mich dorthin fuhr, also ging ich zu Fuß. Als ich am späten Nachmittag wieder nach Hause kam, war niemand da außer Erma, die nie einen Fuß vor die Tür setzte. Sie stand in der Küche, rührte in einem Topf mit grünen Bohnen und nahm immer wieder einen kräftigen Schluck aus einer Schnapsflasche, die in ihrer Kitteltasche steckte.
»Na, wie war's im Niggerdorf?«, fragte sie.
Erma schimpfte andauernd über die »Nigger«. Das Haus von ihr und Grandpa lag an der Court Street, am Rande des Schwarzenviertels. Sie war verärgert gewesen, als immer mehr Schwarze in jenen Teil der Stadt zogen, und sie sagte oft, es wäre deren Schuld, dass es mit Welch so bergab gegangen war. Wenn man im Wohnzimmer saß, wo Erma immer die Jalousien heruntergelassen hatte, konnte man manchmal Gruppen von Schwarzen hören, die plaudernd und lachend in die Stadt gingen. »Gottverdammte Nigger«, murmelte Erma dann. »Der Grund, warum ich dieses Haus seit fünfzehn Jahren nicht verlassen habe«, erzählte sie uns oft, »ist der, dass ich keinen Nigger sehen und von keinem gesehen werden will.«
Mom und Dad hatten uns verboten, dieses Wort zu benutzen. Es war viel schlimmer als alle anderen Schimpfwörter. Aber da Erma meine Großmutter war, hatte ich nie etwas gesagt, wenn sie es benutzte.
Erma rührte weiter in den Bohnen. »Mach nur weiter so, dann denken die Leute noch, du wärst eine Niggerfreundin«, sagte sie.
Sie bedachte mich mit einem ernsten Blick, als erteilte sie mir eine wichtige Lektion fürs Leben, die ich mir hinter die Ohren schreiben sollte. Dann schraubte sie den Verschluss von ihrer Schnapsflasche ab und nahm einen langen, nachdenklichen Schluck.
Als ich sie trinken sah, spürte ich, wie sich in meiner Brust ein unglaublicher Druck aufbaute, und ich hatte das Gefühl, ich müsste ihn rauslassen, sonst würde er mich umbringen. »Das Wort darf man nicht
Weitere Kostenlose Bücher