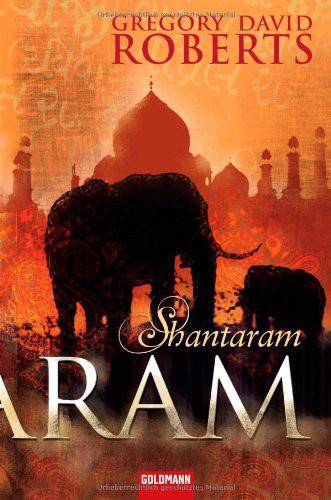![Shantaram]()
Shantaram
früh dran«, bemerkte Salman munter. Ich zuckte zusammen und zwang mich, in die Gegenwart zurückzukehren.
»Kann sein.«
»Die kommen mit dem Auto, und wir sind früher da, obwohl wir zu Fuß gegangen sind«, sagte Salman.
»Das ist auch eine schöne Strecke. Nachts ist es noch wunderbarer. Ich gehe diesen Weg vom Causeway zum Victoria Terminus häufig zu Fuß. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken zum Spazierengehen.«
Salman sah mich an. Auf seinen Lippen lag ein Lächeln, und sein leichtes Stirnrunzeln betonte die schiefe Stellung seiner Augen.
»Du liebst diese Stadt wirklich, wie?«, fragte er.
»Klar«, antwortete ich leicht abwehrend. »Das heißt nicht, dass ich alles hier toll finde. Es gibt auch vieles, was mir nicht gefällt. Aber ich liebe Bombay, und ich denke, das wird auch immer so bleiben.«
Heute weiß ich, was mir damals zustieß, was mich überwältigte, was mich verzehrte und beinahe zerstörte. Didier hatte diesem Gefühl sogar einen Namen gegeben: »Meuchelschmerz« hatte er es genannt – jenen Schmerz, der einem auflauert und dann gnadenlos und ohne Vorwarnung aus dem Hinterhalt angreift. Heute weiß ich, dass Meuchelschmerz sich jahrelang verstecken und dann plötzlich an einem glücklichen Tag ohne erkennbaren Grund und ohne Vorankündigung zuschlagen kann. Doch an diesem Tag, sechs Monate nach Beginn meiner Arbeit in der Fälscherwerkstatt und fast ein Jahr nach Khaders Tod, verstand ich diese zitternde düstere Stimmung in mir nicht, die sich zu der Trauer auswuchs, die ich so lange verleugnet hatte. Ich verstand sie nicht und versuchte sie deshalb so zu bekämpfen, wie ein Mann Traurigkeit oder Verzweiflung bekämpft. Aber Meuchelschmerz kann man sich nicht verbeißen, und man kann ihn auch nicht verscheuchen. Der Feind belauert jeden Schritt und ahnt jede Bewegung voraus. Der Feind ist das eigene leidende Herz, und wenn es angreift, verfehlt es niemals sein Ziel.
Salman wandte sich mir zu. Seine bernsteinfarbenen Augen schimmerten nachdenklich.
»Damals, als wir Ghanis Leute in diesem Krieg ausschalten wollten, versuchte Farid ein neuer Abdullah zu sein. Er liebte diesen Mann, weißt du, wie einen Bruder. Und ich glaube, er versuchte sogar wie Abdullah zu sein. Er hatte wohl das Gefühl, dass wir einen neuen Abdullah bräuchten, um diesen Krieg zu gewinnen. Aber so etwas funktioniert nie, nicht wahr? Ich versuchte ihm das zu vermitteln. Ich sage das all diesen jungen Männern – vor allem, wenn sie versuchen, wie ich zu sein. Man kann nur man selbst sein. Je angestrengter man versucht, ein anderer zu sein, desto mehr steht man sich selbst im Weg. Ah, da sind die Jungs!«
Ein weißer Ambassador kam vor uns zum Halten. Farid, Sanjay, Andrew Ferreira und ein tougher vierzigjähriger Muslim aus Bombay namens Amir entstiegen dem Wagen und gesellten sich zu uns. Wir schüttelten uns die Hand, und der Ambassador entfernte sich.
»Lasst uns noch einen Moment hier warten, bis Faisal den Wagen geparkt hat«, schlug Sanjay vor.
Faisal, der mit Amir für die Schutzgelderpressungen zuständig war, musste tatsächlich den Wagen parken. Doch in erster Linie hatte Sanjay diesen Vorschlag gemacht, weil er es genoss, an diesem strahlenden Nachmittag mitsamt einer Truppe auffälliger Männer, wie wir es waren, am Straßenrand zu stehen und die flüchtigen, aber begehrlichen Blicke der Mädchen aufzufangen, die vorbeispazierten. Wir waren Goondas, Gangster, und jeder wusste es. Wir trugen teure neue modische Kleidung. Wir waren durchtrainiert und selbstsicher. Und wir waren bewaffnet und gefährlich.
Faisal kam hinter einer Ecke hervorgesprintet und bedeutete uns mit einem Kopfwiegen, dass er das Auto sicher geparkt hatte. Wir begaben uns zu ihm und legten die drei Straßen zum Taj Mahal Hotel Seite an Seite zurück. Die Strecke vom Regal Circle zum Taj Mahal Hotel führte über weite offene Plätze, auf denen viele Menschen unterwegs waren. Wir ließen uns nicht trennen, sondern die Menge teilte sich für uns. Die Leute sahen uns nach, und hinter uns war Raunen zu vernehmen.
Wir stiegen die weiße Marmortreppe zum Hotel empor und durchquerten das Shamiana-Restaurant im Erdgeschoss. Zwei Kellner wiesen uns den reservierten Tisch an einem hohen Fenster mit Blick in den Innenhof zu. Ich setzte mich an das Tischende, das dem Ausgang am nächsten war. Die drängende düstere Stimmung, die Salmans Bemerkung in mir ausgelöst hatte, verstärkte sich von Minute zu Minute. Ich wollte aufbrechen
Weitere Kostenlose Bücher