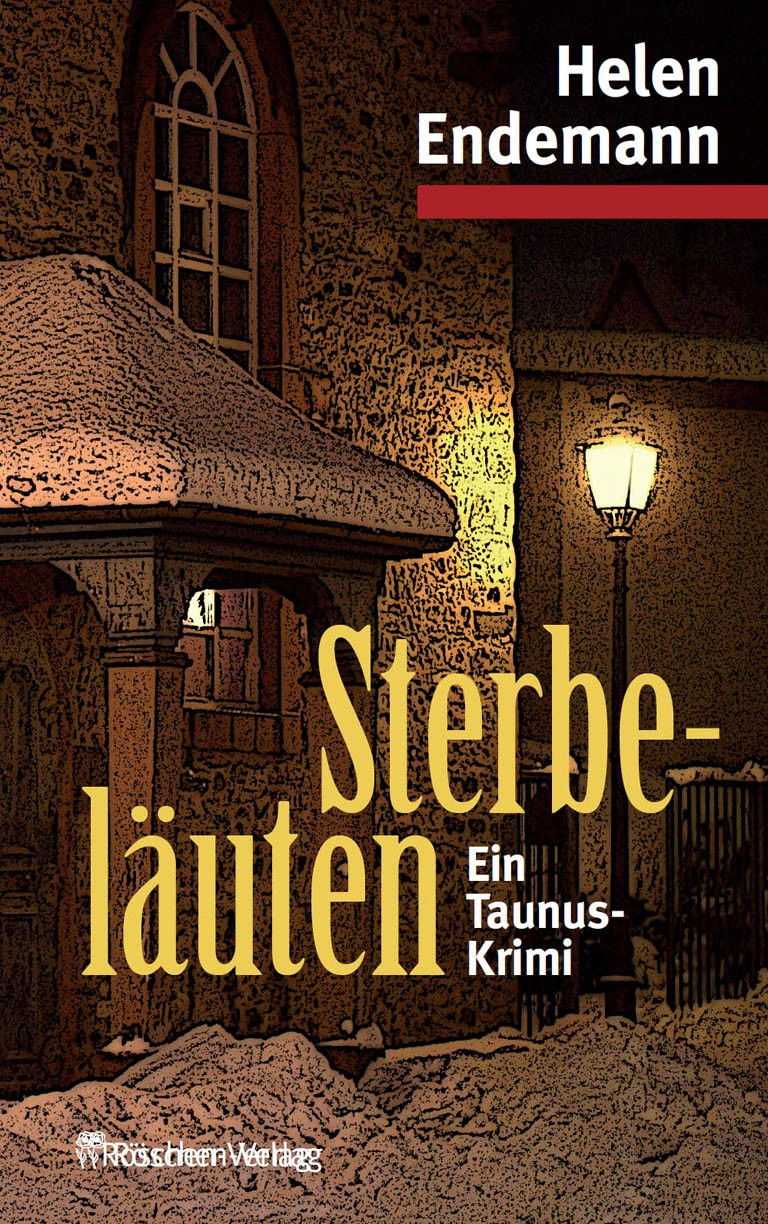![Sterbelaeuten]()
Sterbelaeuten
leer, eine buntgemusterte Tagesdecke lag darauf.
Antoni erschien im Wohnzimmer mit einem Tablett, auf dem ein Teeservice stand. Stephanie folgte ihm. Aus dem Flur trat nun noch ein Mann ein, den Henry beim Hereinkommen nicht bemerkt hatte.
„Kennst du Christian Baumgart? Er ist, äh, ein Freund der Familie“, sagte Sibylle.
Die Männer schüttelten Hände. Henry erinnerte sich, den Mann einige Male im Gottesdienst gesehen zu haben und beim Kirchenkaffee, zusammen mit Sibylle. Er hatte angenommen, er sei ihr Freund, eher als ein Freund der Familie. Offenbar schien Baumgart das auch so zu sehen, denn er setzte sich neben Sibylle auf die Eckbank und nahm ihre Hand in seine Hände, wie um ihr in dieser schweren Stunde beizustehen. Sibylle schien das unangenehm zu sein. Nach einigen Augenblicken zog sie ihre Hand aus Baumgarts Händen, führte sie in einer Verlegenheitsgeste an den Hals und legte sie dann in ihrem Schoß ab.
Als Antoni noch dabei war, das Service vom Tablett auf den Tisch zu räumen, erklang eine elektronische Version der Mondscheinsonate. Antoni fuhr zusammen und hätte beinahe das Tablett fallen gelassen. „Entschuldigung viele Male!“, rief er. „Mein Handy.“ Er stellte das Tablett auf den Tisch, nestelte das Handy aus der Hosentasche und nahm den Anruf an. „Ja, das bin ich. Bitte einen Moment“, sprach er leise in das Handy und verließ schnell das Zimmer. Er ging auf den Flur und man hörte eine Tür zugehen.
„Das muss ja ganz was Geheimes gewesen sein“, sagte Stephanie. Dann gab sie Henry zur Begrüßung die Hand und sie setzten sich an den Tisch.
„Findest du das nicht ein bisschen unpassend?“ Christian sah Sibylle an. „Ich meine, bei einem Trauergespräch kann man ja wohl sein Handy ausstellen.“
Henry unterdrückte den Impuls, in der Jackentasche nach seinem Handy zu tasten. Sibylle sah Christian nur an, fand offenbar aber keine Kraft, ihm zu antworten.
„Ich nehme an, Antoni hat noch eine Kündigungsfrist, die jetzt läuft, oder?“ Christian hatte die Frage an Stephanie gerichtet, die ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansah.
„Warum interessiert dich das, Christian?“, fragte sie.
„Ich denke halt nur.“ Christian setzte sich aufrechter hin. „Ihr braucht ihn ja jetzt nicht mehr und wenn er trotzdem noch für euch arbeitet, dachte ich, wird es daran liegen.“
„Antoni ist ein Freund der Familie. Er hat unsere Mutter liebevoll gepflegt. Ich hätte diese Zeit niemals überstanden ohne seine Hilfe.“ Sibylle war sichtlich von Christian abgerückt und saß ebenfalls mit durchgestrecktem Rücken da. „Deshalb ist er heute hier.“
Antoni kam zurück ins Zimmer und setzte sich auf den äußersten Rand der Eckbank. Er wirkte unruhig. Christian lehnte sich in seine Rückenlehne zurück und faltete die Hände im Schoß. Offenbar hatte er nicht so bald vor, wieder etwas zu sagen.
„Wir haben Tee gemacht, oder würdest du lieber Kaffee trinken?“, sagte Stephanie zu Henry.
„Tee ist prima“, erwiderte er. Die Frage war wohl eher, warum Christian hier war, dachte Henry. Seinem Eindruck nach ging er nicht nur Stephanie, sondern auch Sibylle mächtig auf die Nerven. Henry hätte lieber mit Stephanie und Sibylle allein gesprochen, ohne den nervös zappelnden, sich sichtlich unwohl fühlenden Antoni in der einen und den schmollenden Christian in der anderen Ecke.
Er legte seinen Notizblock auf den Tisch. Stephanie goss Tee ein, und Henry fing an, seinen merkwürdigen Job zu machen, der darin bestand, meistens mehr und manchmal weniger fremde Menschen dazu zu bringen, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Er stellte ein paar Fragen, machte ein paar Bemerkungen, interessierte sich für dies und das, und die Leute fassten Vertrauen und erzählten. So auch Sibylle und Stephanie.
Sie erzählten von Katharina Heinemanns Kindheit in Schlesien, wo sie als Tochter eines Arztes aufwuchs. Von der Flucht, die sie auf Umwegen über Dresden nach Erfurt brachte. Dort hatte die Familie ungewöhnlich großes Glück und wurde in einem Gutshof von einer Familie aus einem niedrigen Thüringer Adelsgeschlecht aufgenommen. Die Gutsherrin – von Katharina immer nur „die Gräfin“ genannt – brachte ihr das Klavierspielen bei, „Weil unsere achtjährige Mutter sich jedes Mal unter den Flügel der Gräfin schlich, sobald diese anfing, Klavier zu spielen“, erzählte Sibylle.
„Die Gräfin“ setzte außerdem durch, dass das Flüchtlingskind in die Kantorei des Erfurter
Weitere Kostenlose Bücher