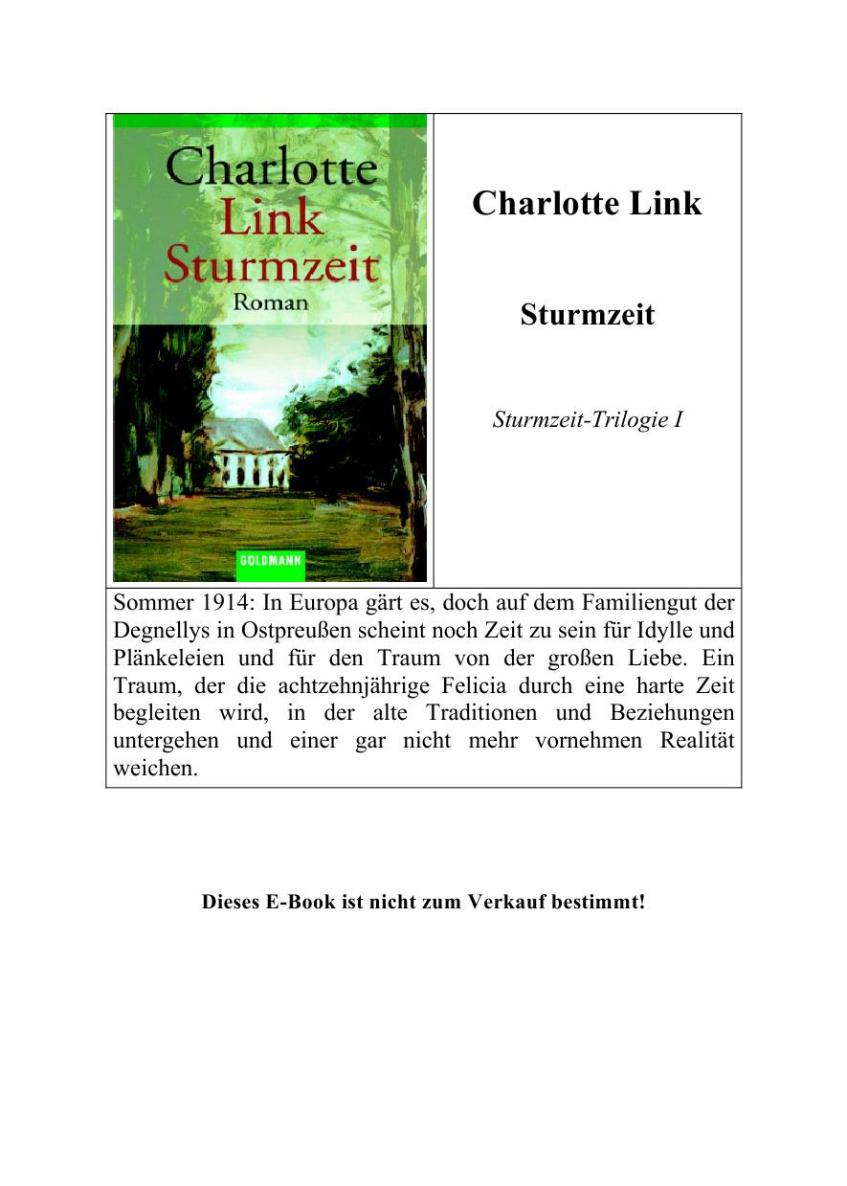![Sturmzeit]()
Sturmzeit
früher für flatterhaft und oberflächlich. Eigentlich sah ich eure Freundschaft nie besonders gern.«
»Warum läßt du mich dann fort zu ihr?«
Frau Winterthal konnte durchaus realistisch denken. »Man weiß nicht, wie die Zeiten werden. Es ist gut, einen Menschen zu haben, an dem man sich festhalten kann. Felicia gehört zu denen, die aus irgendeinem geheimnisvollen Grund ihr ganzes Leben lang immer wieder auf die Füße fallen.«
Die erste Begegnung zwischen Felicia und Benjamin nach über einem Jahr war von einer beinahe unerträglichen Spannung begleitet. Keiner von beiden wußte, was er sagen sollte, und sie umarmten einander so distanziert, daß kein fremder Beobachter auf den Gedanken gekommen wäre, zwei Leute vor sich zu haben, die miteinander verheiratet waren.
Beide gelangten schon nach ein paar Minuten zu der Erkenntnis, daß sie einander eigentlich nicht kannten; eine Tatsache, die Felicias stets vorhandenes Gefühl bestätigte und Benjamin in tiefste Verwunderung stürzte.
Er sah elend aus, blaß und übernächtigt, die Augen hatten rote Ränder. Es war Felicia im ersten Moment nicht aufgefallen, aber nun bemerkte sie, daß er einen schwarzen Anzug trug und auch eine schwarze Krawatte. Von einer seltsamen Scheu befangen wagte sie es nicht, sogleich die Frage zu stellen, die ihr auf den Lippen brannte. Sie setzte sich und hielt sich im letzten Moment davor zurück, eine Zigarette anzuzünden. Es war ihr ohnedies peinlich genug bewußt, daß ihr Kleid zu tief ausgeschnitten, ihre Strümpfe zu dünn, ihre Schuhe zu hochhackig und ihre Ohrringe zu funkelnd waren. Ihre Aufmachung, vorhin im Adlon noch ganz richtig und passend, nahm sich hier in dem stillen, altmodischen Wohnzimmer mit seinen Biedermeiermöbeln wie ein grellbunter Mißgriff aus. Benjamins dunkler Anzug und Elsas graues Vorkriegskleid schienen ein greifbar gewordener Vorwurf. Ein einzelner Sonnenstrahl fiel durch das Fenster und ließ den Staub auf Felicias Porträt flimmern. Felicias und Benjamins Augen folgten dem Sonnenstrahl gleichzeitig, verweilten sekundenlang auf dem Bild und konnten in den zarten Zügen nichts von der Gegenwart entdecken.
»Es tut mir leid, daß ich dich habe warten lassen, Benjamin«, sagte Felicia, »ich hatte eine wichtige Besprechung. Sie dauerte länger als erwartet - aber dafür hab' ich sie erfolgreich abgeschlossen.«
»Herzlichen Glückwunsch«, das klang stockend. »Nach allem, was man hört, bist du überhaupt recht erfolgreich.«
»Ich arbeite sehr angestrengt. Es fällt mir nichts zu.«
»Ja, sicher. Du bist sehr dünn geworden.«
»Steht mir doch, oder?« Felicia stellte diese Frage mit einem provokanten Unterton. Sie wußte genau, daß ihm ihre überschlanke Figur nicht gefiel.
»Natürlich. Steht dir sehr gut.« Seine Augen tauchten in Felicias, hilfesuchend, zärtlich, um eine Erwiderung seiner Liebe in ihrem Blick bettelnd. Felicia wandte sich ab. Sie merkte, daß ihre Mutter nervös ihre Finger ineinanderknetete und hastig atmete. Sie zog die Augenbrauen hoch. »Was ist denn los? Wo sind überhaupt meine Kinder?«
Benjamin hustete. Er trat an Felicia heran, setzte sich neben sie und nahm ihre Hand. »Ich habe eine sehr traurige Nachricht für dich«, begann er. Felicia wurde blaß. »Belle?«
»Nein, es ist nichts mit den Kindern. Ich habe sie bloß nicht mit nach Berlin gebracht, weil wir beide morgen nach Insterburg fahren müssen und du sie dann ja sowieso siehst.«
Sie entzog ihm ihre Hand und rückte unmerklich ein Stück ab. Ihr Gesicht versteinerte. »Was heißt das? Wir beide fahren morgen nach Insterburg? Davon weiß ich überhaupt nichts!«
Benjamins Lippen zuckten. Er wandte sich ab, barg sein Gesicht in den Händen. Seine Schultern zitterten. »Du weißt auch noch nicht... du weißt nicht...« Sie konnte ihn kaum verstehen. »Du weißt auch noch nicht, daß meine Mutter vor zwei Tagen gestorben ist.«
»Einen Sherry?« fragte Wolff und lächelte seinem Besucher zu. Marco Carvelli, vom Modehaus Carvelli in München, kauerte ein wenig unbehaglich in seinem Sessel. Er sah aus wie eine Katze, die vor einer schmutzigen Pfütze sitzt und überlegt, ob sie tatsächlich hindurchwaten soll, um an die Sahne zu gelangen, die am anderen Ufer aufgestellt ist.
»Ich... äh...«, sagte er stotternd. Wolff schenkte ihm den Sherry ein und reichte ihm das Glas. »Sie sind ein kluger Mann, nicht wahr, Carvelli? Und Sie kennen mich schon lange. Sie haben mich nie sehr gemocht, aber
Weitere Kostenlose Bücher