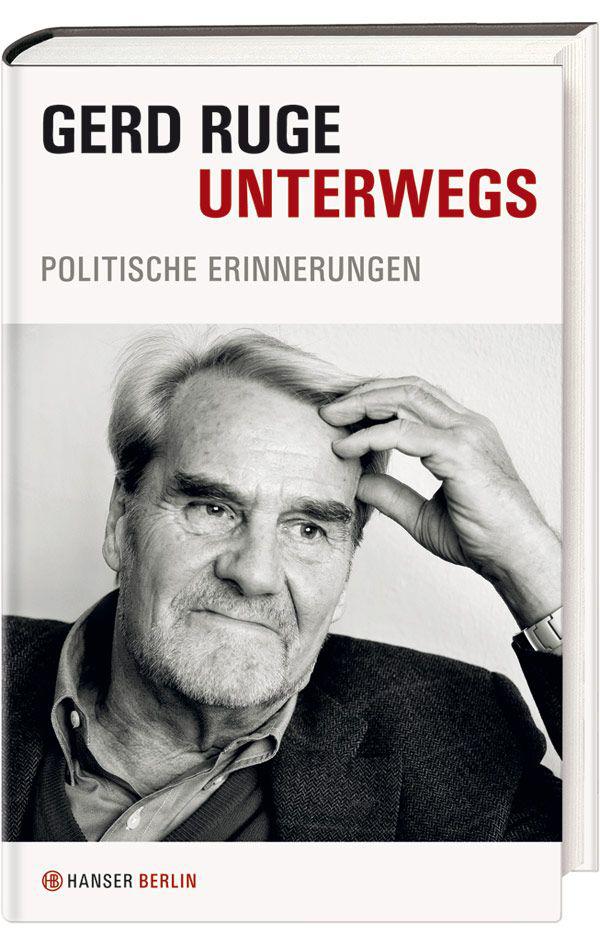![Unterwegs: Politische Erinnerungen (German Edition)]()
Unterwegs: Politische Erinnerungen (German Edition)
verbunden war. Im Grunde hätte es zwischen dem Präsidentenbruder aus der feinen Gesellschaft des Nordostens und dem Ellenbogenpolitiker, dem Sohn kleiner Farmer vom Rande der Südstaaten, eine nützliche Arbeitsteilung geben können. Doch die beiden Männer waren einfach zu unterschiedlich, zu sehr Machtpolitiker und zu tief verstrickt in ihre Feindschaft. Robert Kennedy lud mich einige Male zu einem Softball-Spiel, einer Art Schlagball, in seinen Garten ein. Lyndon Johnson hingegen traf ich am ehesten, wenn ich am Samstagvormittag in den Presse-Arbeitsraum des Weißen Hauses ging und mit amerikanischen Kollegen ein oder zwei Stunden wartete: Dann kam er, spazierte mit uns um den großen Rasen hinter dem Weißen Haus und ließ uns einen Whiskey einschenken.
Als deutscher Korrespondent beobachtete ich das gespannte Verhältnis der beiden mit besonderer Besorgnis, denn gerade in dieser Zeit war eine starke amerikanische Führung gefragt. In den knapp drei Jahren, die John F. Kennedy Präsident war, ging es zwischen Moskau und Washington darum, wer über die Zukunft des geteilten Berlin und des geteilten Deutschland bestimmen würde. Kennedy war knapp zwei Jahre nach dem Mauerbau demonstrativ zu einem offiziellen Besuch nach West-Berlin gekommen und hatte Amerikas Unterstützung für die Stadt bekräftigt. Zur anderen großen Belastung der amerikanischen Außenpolitik wurde der Krieg in Vietnam. Washingtons militärischer Beitrag zur Unterstützung der sich abwechselnden vietnamesischen Politiker und Generäle verdreifachte sich in Kennedys kurzer Amtszeit, doch bis zu seinem Tod war noch nicht klar, welche Richtung die amerikanische Vietnam-Politik auf Dauer einschlagen würde. Im Herbst 1963 konnte in Washington freilich niemand ahnen, wie schnell die Entscheidungen von Kennedy an Lyndon Johnson übergehen würden.
Am 22. November befand ich mich in einem Flugzeug auf dem Weg von Washington nach Mississippi. Ich saß schläfrig in meinem Flugzeugsessel, als sich der Pilot über die Lautsprecheranlage meldete und so nüchtern wie möglich eine brisante Meldung durchzugeben versuchte: Präsident Kennedy sei soeben in Dallas ermordet worden. Einige Reihen hinter mir sprangen zwei junge Männer auf und riefen »Yippee!« – ein Schrei, in dem sich aufgestauter Hass entlud. Aber die verstörten Blicke der anderen Passagiere zwangen die beiden schließlich in ihre Sitze zurück. Der Pilot gab von Zeit zu Zeit die neuesten Meldungen aus Atlanta an uns Passagiere weiter, und dann schwiegen alle. Ich wollte statt nach Mississippi natürlich so schnell wie möglich zurück nach Washington. Beim nächsten Stopp in Knoxville, Tennessee, stieg ich aus. Im Flughafengebäude traf ich zufällig einen weißen Prediger, den ich von früheren Begegnungen kannte. Er hatte sich jahrelang für die Rechte der Schwarzen eingesetzt, bis so oft auf ihn geschossen wurde, dass er seine kleine Kirche verlassen musste. Nun lud er mich ein, bis zum nächsten Flug nach Washington mit ihm in der Highlander Folk School zu übernachten, die ich, bevor sie von Monteagle nach Knoxville vertrieben worden war, 1950 bei meinem ersten Besuch kennengelernt hatte. Da saßen wir dann zusammen mit einigen Studenten und jungen Gewerkschaftlern und starrten auf den Bildschirm des Fernsehgeräts. Wir sahen Bilder von Präsident Kennedy und Jacqueline auf der großen Paradefahrt durch Dallas. Es gab noch keine Aufnahmen vom Attentat selbst, nur die Berichte der Reporter und schließlich jenen Augenblick, in dem einer von Kennedys Assistenten in Dallas vor die Tür des Krankenhauses trat und sagte, der Präsident sei tot.
Abends lief ich durch Knoxville, eine Stadt am nördlichen Rand der Südstaaten, wo die Leute Präsident Kennedy nicht geliebt, ja vielfach sogar gehasst hatten. An diesem Abend schlossen hier keine Bar und kein Kino, und im städtischen Sportstadion wurde weiter ein Eishockey-Match ausgetragen. Nur im ärmsten Teil der Stadt fand ich eine Kirche, in der viele Schwarze verstört für den toten Präsidenten beteten. Auch in den nächsten Tagen blieb die Reaktion auf den Mord in vielen Städten des Südens unter den Weißen erschreckend kühl. Die Stadtverwaltungen beschlossen, keine Trauertage einzulegen. Die Kneipen wurden beispielsweise nur zwei Stunden lang, während der Beisetzung selbst, geschlossen.
Wäre ich in dieser Nacht in Washington oder im nördlichen Teil der USA gewesen, hätte ich eine ganz andere Stimmung erlebt. Dort waren
Weitere Kostenlose Bücher