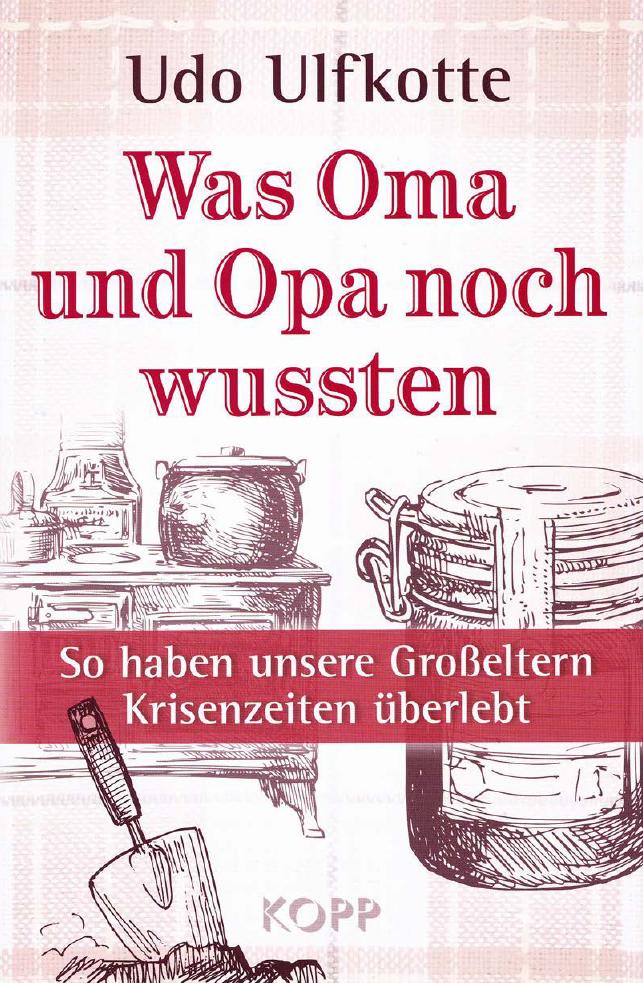erste zarte Köpfchen zeigen, dann entfernt man sie ganz. Rund vier Wochen später brechen dann die ersten Pilze hervor. Wer in einem feuchten Wald die eigene Pilzzucht erproben will, der bekommt viele nützliche Hinweise von einem österreichischen Pri vatmann, der auch seine Pilzsporen für das Impfen selbst züchtet: Ing. Herbert Wurth, Mistelbach 28, Ö-3922 Groß Schönau, E-Mail:
[email protected] , www.pilzgarten.at
Allerdings gibt es im Schrebergarten und auch im Wald einen Feind der Pilzkultur, den man kennen sollte: Schnecken lieben Pilze. Der Geruch des Myzels zieht sie magisch an. Und Schnecken kommen genau dann, wenn man nicht nach seinen Pilzen schaut - in der Nacht und wenn es regnet. Sie fressen dann die winzig kleinen Pilz- köpfe auf. Man kann das alles leicht umgehen, wenn man die Pilzkul- tur in einer alten, modrig-feuchten Scheune anlegt und um die Baumstämme herum großflächig Stroh auslegt. Dann kommen die Schnecken garantiert nicht.
Als Einstieg empfehlen sich Versuche mit dem heimischen Stock- schwämmchen. Es ist der wohl schmackhafteste heimische Pilz, der
auch von Laien gut im Wald (oder
im eigenen Garten) angebaut wer-
den kann. Das Stockschwämmchen
kommt bei uns im Herbst und Früh-
jahr auf Laubholz vor. Es wächst in
Büscheln, die Stiele sind an der Basis
zusammengewachsen. Es hat einen
aromatischen Pilzgeruch. Der Hut
ist drei bis sechs Zentimeter groß,
honiggelb bis gelbbräunlich, meist
mit dunklerer, zimtbrauner, durch-
wässerten Randzone und fettig glän-
zend. Die Lamellen sind gelblich bis
zimtbraun. Der Stiel ist rostbraun.
Essen Sie keine vermeintlichen
Stockschwämmchen, die Sie als Laie
in der Natur finden. Denn es gibt Verwechselungsmöglichkeiten mit giftigen Doppelgängern wie dem Nadelholzhäubling und dem Grün- blättrigen Schwefelkopf. Das Beste am Stockschwämmchen: interes- santerweise wird es von Schnecken verschont.
Frischfleisch und Fisch
Haltung von Geflügel
Als Eigentümer oder Pächter einer größeren Grünfläche kann man auch Geflügel halten und so in Krisenzeiten für Fleischvorräte sor- gen. Noch vor zwei Generationen war es selbstverständlich, dass vie- le Menschen auf dem eigenen Land Geflügel gehalten haben. Hühner, Gänse und Enten waren ein normaler Anblick - auch in den Randge- bieten der Städte. Heute sieht man selbst auf den Dörfern nur noch selten, wie die Gänse morgens zum nächstgelegenen Weiher getrie- ben werden. Und man hört kaum noch ihr Geschnatter. Von ur- sprünglich mehr als 2,4 Millionen Tieren und deutlich mehr als 200.000 Gänsehaltern im Jahre 1950 sind 2003 nur 380.000 Tiere übrig geblieben - Tendenz stark fallend. Die Ursachen liegen in der Rationalisierung der bäuerlichen Betriebe und dem Druck, nur noch mit Intensivwirtschaft produzieren zu dürfen. Heute kaufen wir in Mastbetrieben unter nicht artgerechten Bedingungen aufgezogenes und vollautomatisch geschlachtetes Geflügel aus der Tiefkühltruhe und haben die Haltung von Geflügel weitgehend verlernt. Die Deut- schen essen jedes Jahr etwa 19 Kilogramm Geflügelfleisch. Der Anteil des Gänsefleisches daran ist mit 300 Gramm im Jahr sehr gering. Die Gans ist (ebenso wie Ente) nach wie vor ein Festtagsbraten. Sie wird nur noch zu Weihnachten und in einigen Regionen zu Martini ver- speist. Über die Direktvermarktung werden Gänse und Enten dann an die Kunden abgegeben. Ich halte auf einer großen Wiese am Ran- de einer Teichanlage Gänse, Enten und Hühner. Vor allem die Gänse sind noch