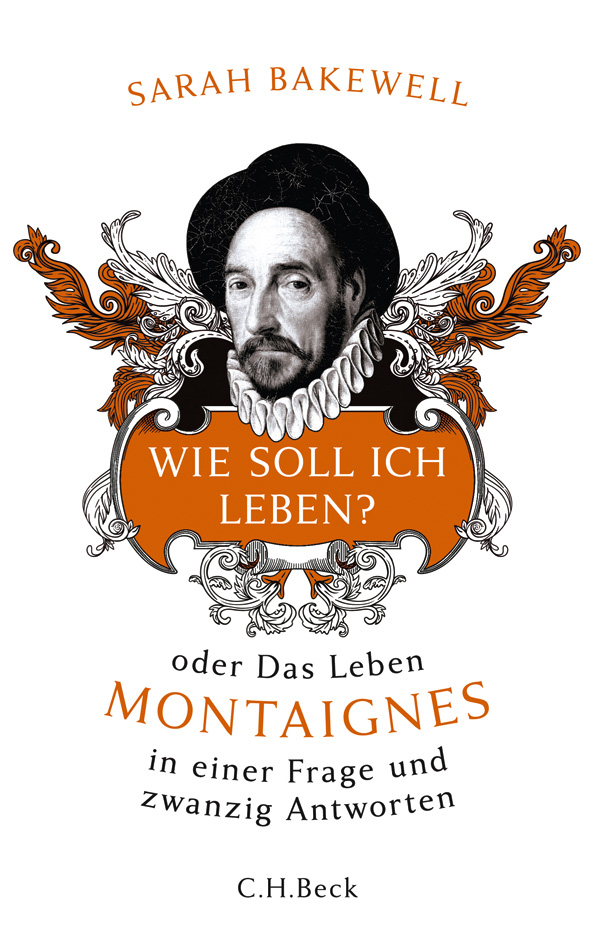![Wie soll ich leben?]()
Wie soll ich leben?
versuchte, sich jeweils auf den gegenwärtigen Augenblick zu konzentrieren. Diese Achtsamkeit war schon eine Grundregel der antiken Philosophen gewesen. Das Leben vollzieht sich, während man mit anderen Dingen beschäftigt ist, sagten sie. Deshalb müsse die Philosophie die Aufmerksamkeit des Menschen immer wieder dorthin zurücklenken, wohin sie gehört: ins Hier und Jetzt. Die Philosophie spielt damit eine ähnliche Rolle wie die Mynas in Aldous Huxleys Roman Eiland: Vögel, die darauf abgerichtet sind, den ganzen Tag herumzufliegen und «Gib acht, gib acht!» und «Hier und jetzt!» zu rufen. Wie Seneca sagt, hält das Leben nicht inne, um einen darauf hinzuweisen, dass es vergeht:
Wenn man versäumt, das Leben festzuhalten, wird es einem entwischen. Aber auch wenn man es festhalten will, wird es entfliehen. Also muss man gegen den schnellen Lauf der Zeit ankämpfen und «wie aus einem reißenden Gießbach, der nicht ständig fließen wird, geschwind trinken».
Der Trick besteht darin, sich in jedem Augenblick ein kindliches Staunen zu bewahren. Und die beste Methode dafür ist, über all das zu schreiben. Einen Gegenstand auf dem Tisch oder den Blick aus dem Fenster zu beschreiben öffnet einem die Augen für das Wunder der gewöhnlichen Dinge. Doch der Blick in das eigene Innere eröffnet eine noch phantastischere Welt. Der Philosoph Maurice Merleau-Ponty nannte Montaigne einen Autor, der «ein über sich selbst staunendes Bewusstsein als den Kern der menschlichen Existenz» begriff. Und für Colin Burrow, einen zeitgenössischen Literaturkritiker, war das Staunen neben Montaignes anderer Hauptqualität, der fließenden, sich unablässig verändernden Leichtigkeit, etwas, was die Philosophie in ihrer abendländischen Tradition nur selten erreichte.
Mit zunehmendem Alter verstärkte sich Montaignes Wunsch, dasLeben staunend zu betrachten, nur noch mehr. Am Ende des langen Prozesses der Arbeit an den Essais hatte er diese Kunst fast zur Perfektion gebracht. Er wusste, dass sich sein Leben dem Ende zuneigte, und schrieb: «Ich will, dass es an Gewicht zunehme; ich will der Schnelligkeit seiner Flucht durch die Schnelligkeit meines Zugriffs Einhalt gebieten […]. Je kürzer ich das Leben noch besitze, desto tiefer und umfassender muss ich von ihm Besitz ergreifen.» Beim Spazierengehen entdeckte er eine Meditationstechnik:
Wenn ich einsam durch einen schönen Park spaziere und meine Gedanken sich eine Zeitlang mit anderweitigen Dingen beschäftigen, lenke ich sie dann eine Zeitlang auf den Spaziergang zurück, auf den Park, auf den Zauber dieser Einsamkeit, auf mich.
In Augenblicken wie diesen scheint er beinahe das Ziel des Zen erreicht zu haben: einfach nur zu sein.
Wenn ich tanze, tanze ich, und wenn ich schlafe, schlafe ich.
Es klingt simpel, aber nichts ist schwerer als das. Deshalb verbringen Zen-Meister auch ihr ganzes Leben oder mehrere Leben damit, dies zu lernen. Und selbst dann gelingt es ihnen erst, wenn ihnen ihr Lehrer mit einem Stock, dem keisaku , einen Schlag auf den Kopf versetzt, um ihnen zu helfen, sich bei der Meditation zu konzentrieren. Montaigne hat diesen Zustand am Ende eines einzigen, recht kurzen Lebens erreicht, nicht zuletzt deshalb, weil er einen Großteil dieses Lebens damit verbracht hat, mit einer Feder aufs Papier zu kritzeln.
Indem er über diese Erfahrungen schrieb, als wäre sein Leben selbst ein Fluss, begründete er eine literarische Tradition der Selbstbeobachtung, die uns heute so vertraut ist, dass wir uns erst einmal klarmachen müssen, dass es tatsächlich eine Tradition ist. Das Leben tritt uns entgegen, wie es ist, und das Wechselspiel innerer Zustände zu beobachten ist die Aufgabe des Schriftstellers. Vor Montaigne war dies keineswegs ein selbstverständlicher Gedanke, und sein eigentümlich ruheloses, frei dahinmäanderndes Schreiben war etwas vollkommen Neues. Indem Montaigne es erfunden und damit einen zweitenVersuch einer Antwort auf die Frage unternommen hat, wie man leben soll – «Lebe den Augenblick!» –, überwand er seine Krise und münzte sie sogar in etwas Positives um.
«Habe keine Angst vor dem Tod!» und «Lebe den Augenblick!» waren Montaignes Antworten auf seine Orientierungslosigkeit in der Mitte seines Lebens. Sie entsprangen der Erfahrung eines Menschen, der lange genug gelebt hatte, um Fehler und Irrtümer zu begehen. Sie markierten aber auch einen Neuanfang: die Geburt eines neuen, Essais schreibenden Ichs.
3
Frage: Wie soll ich
Weitere Kostenlose Bücher